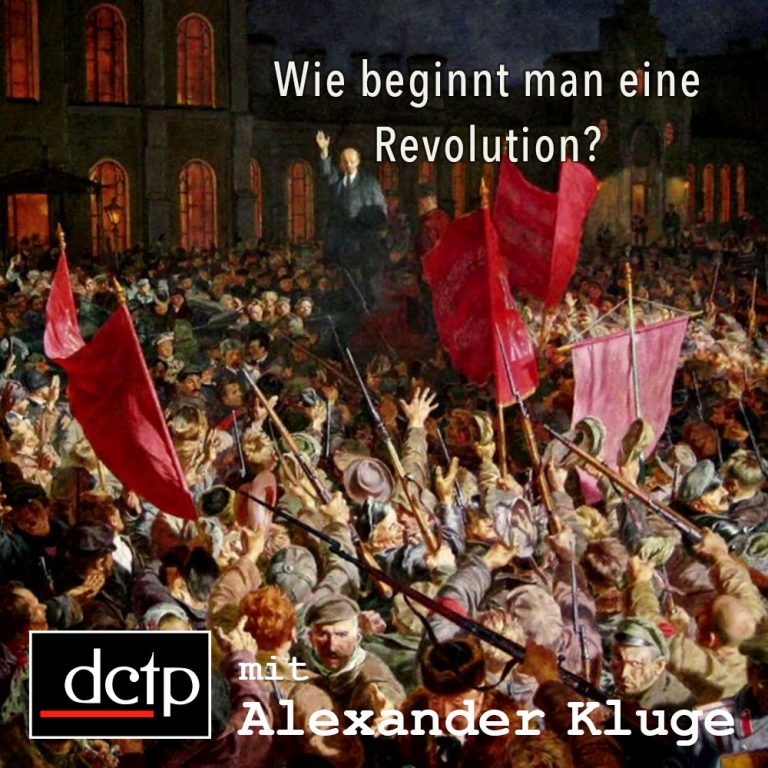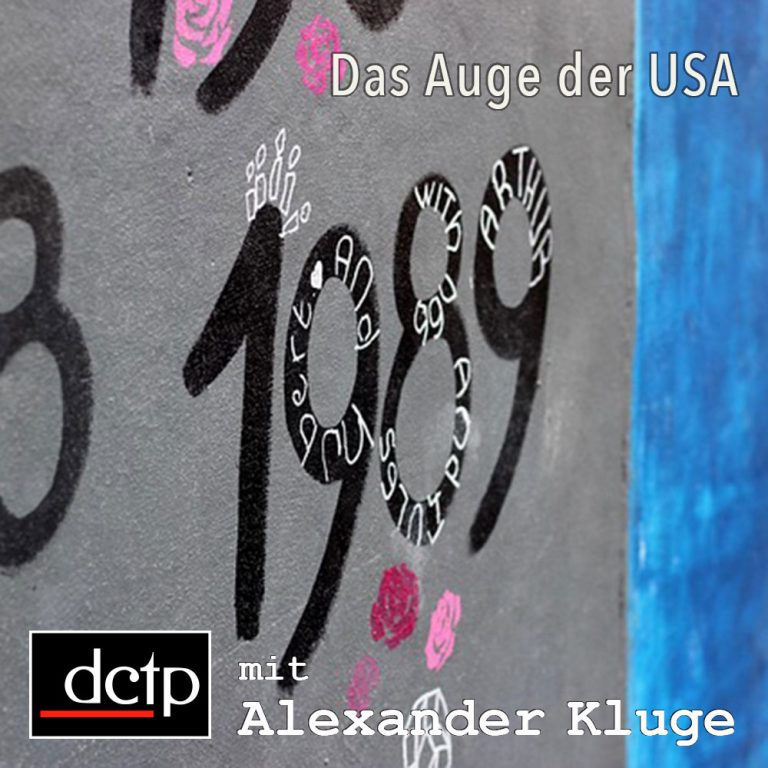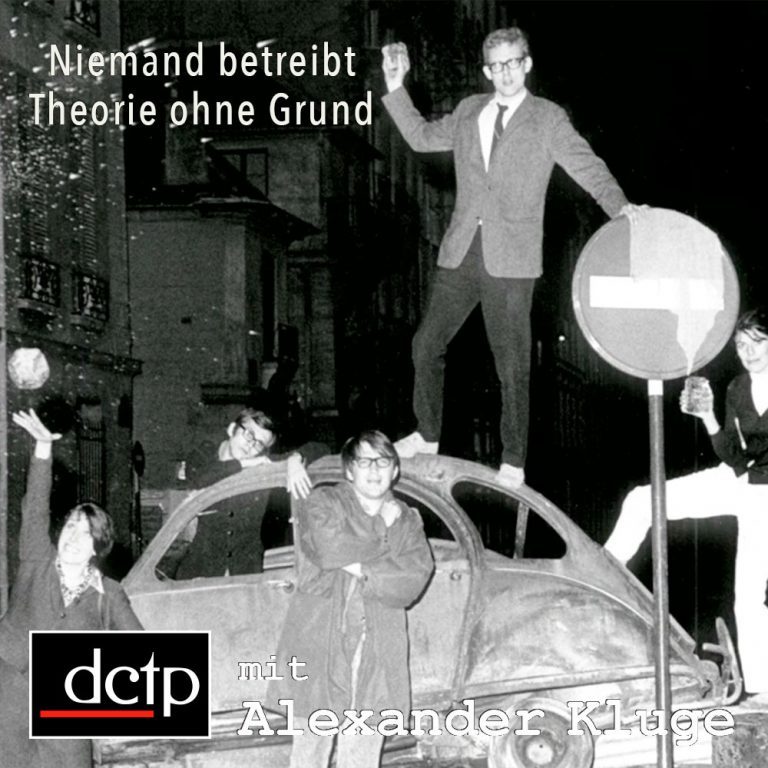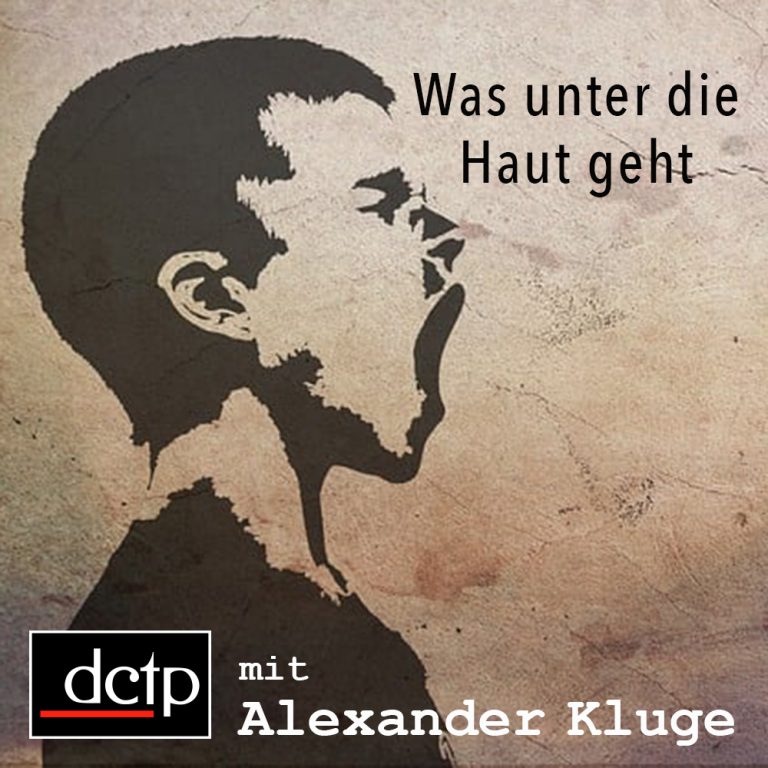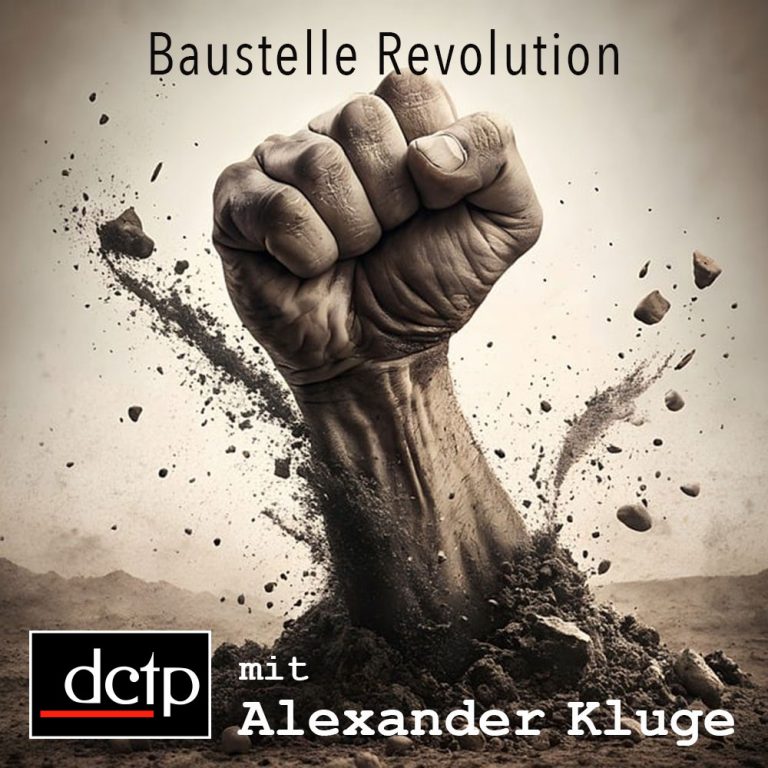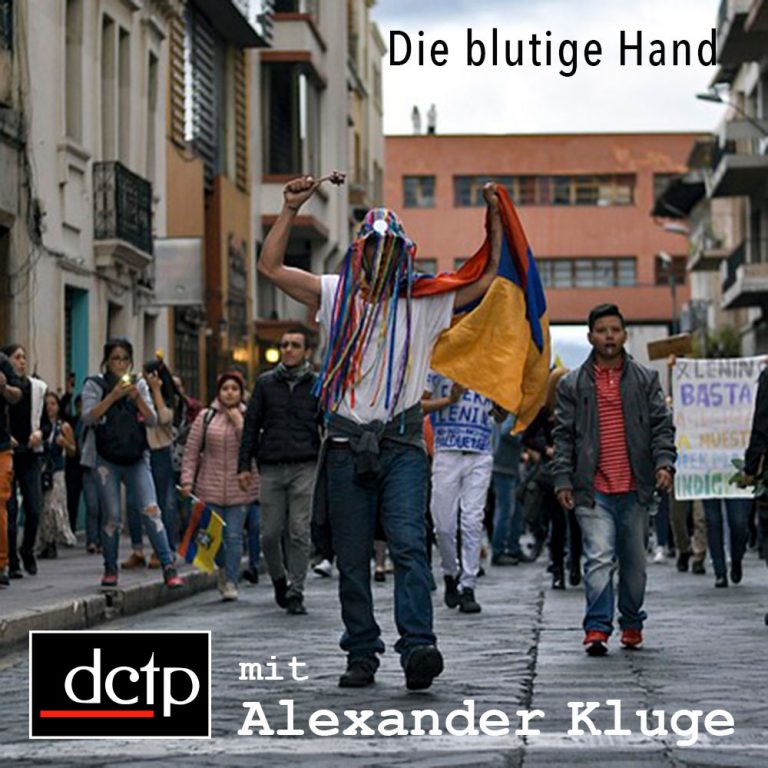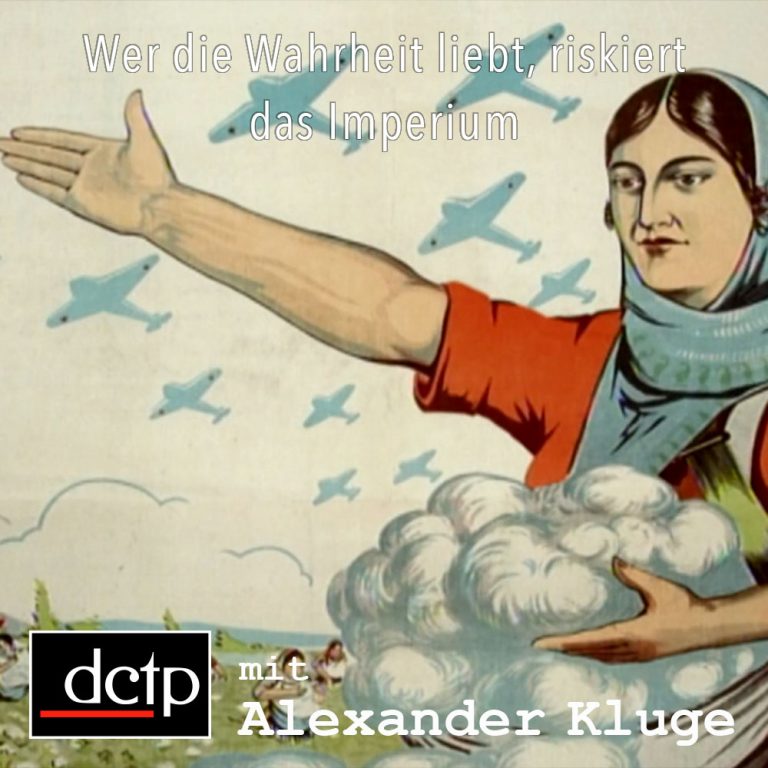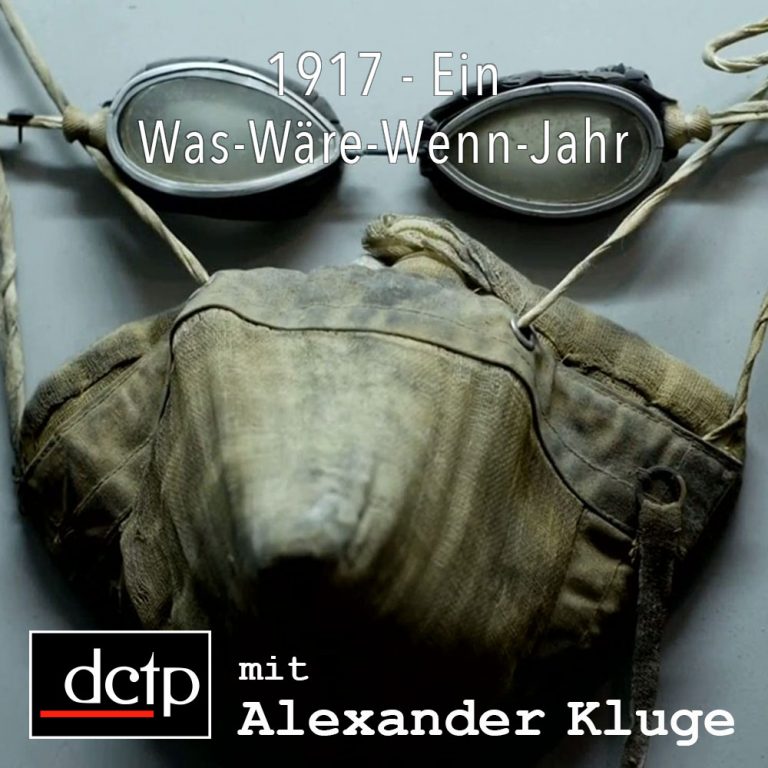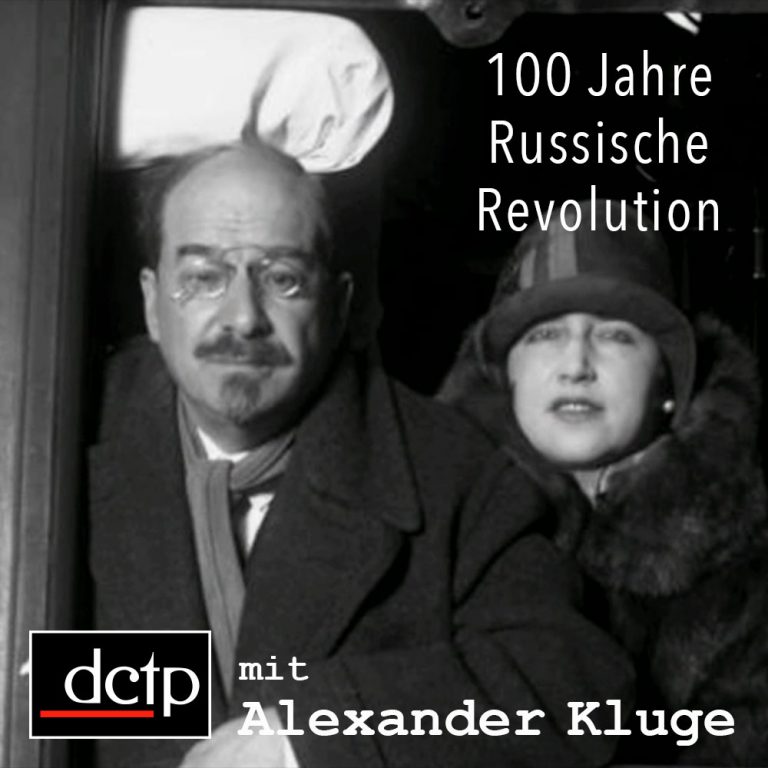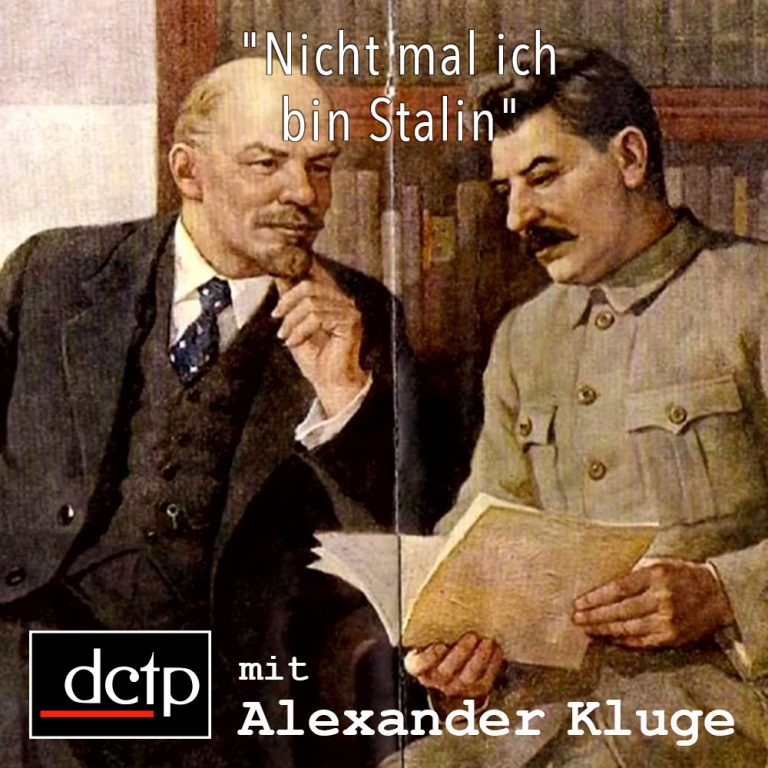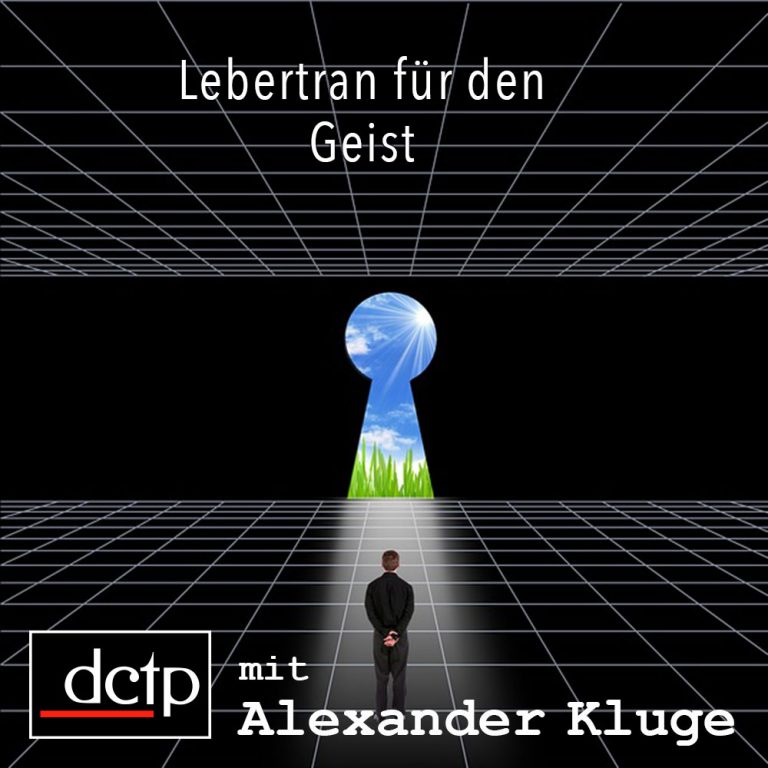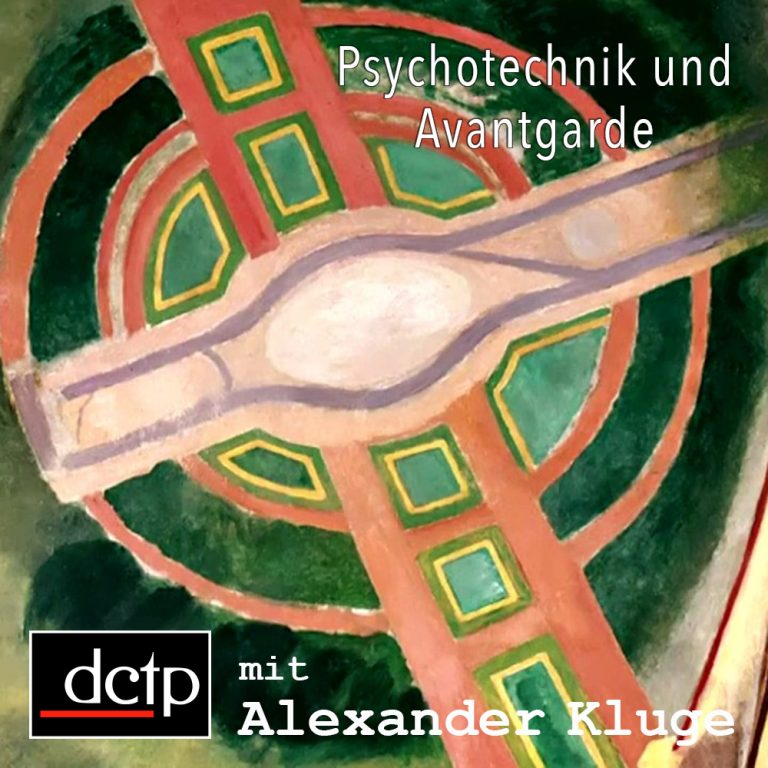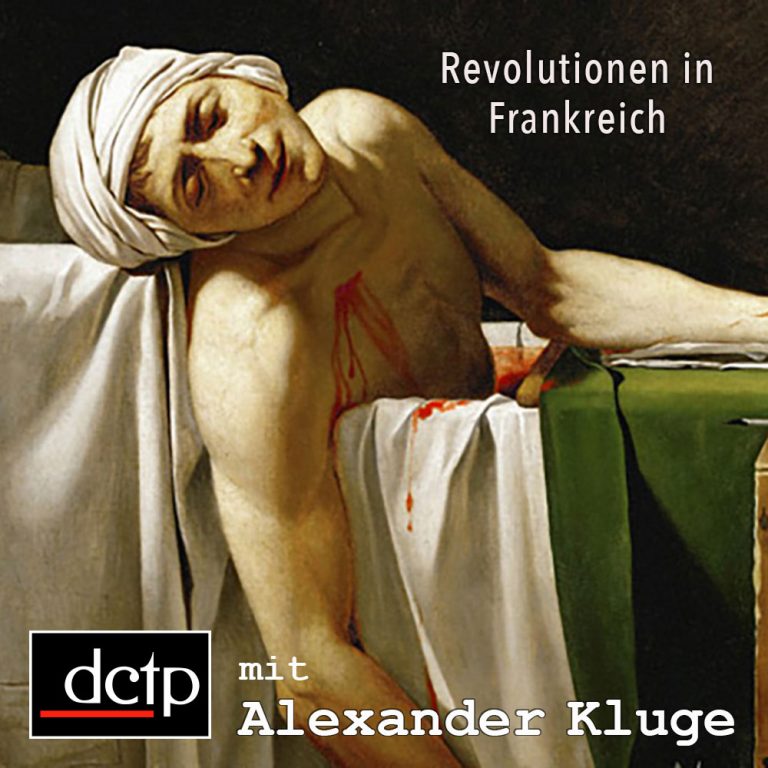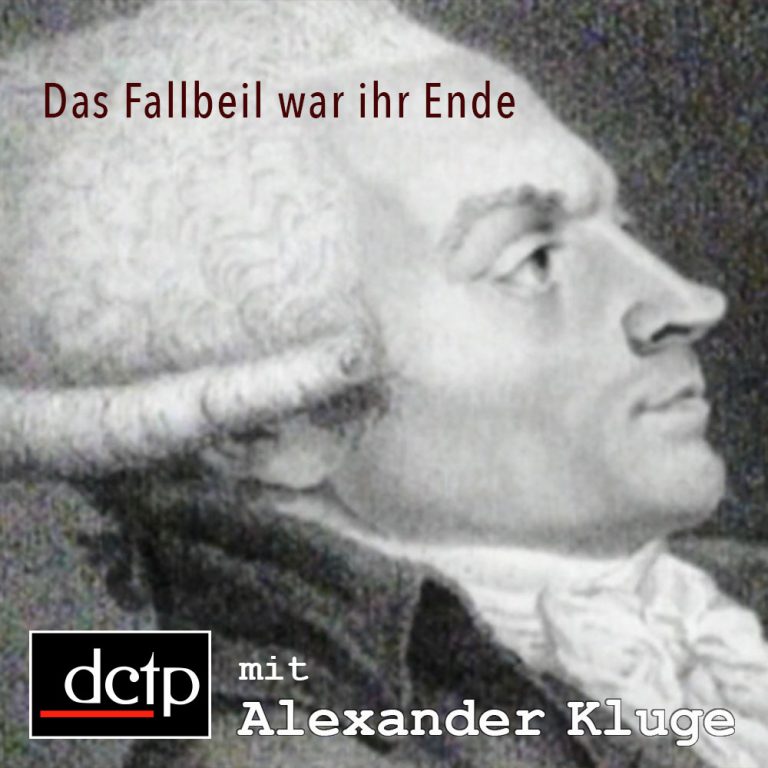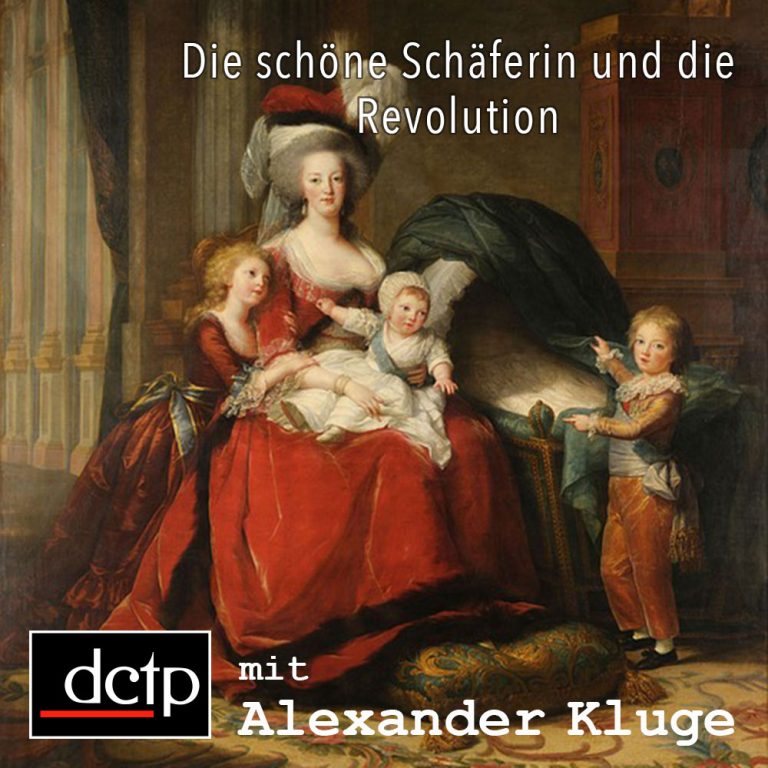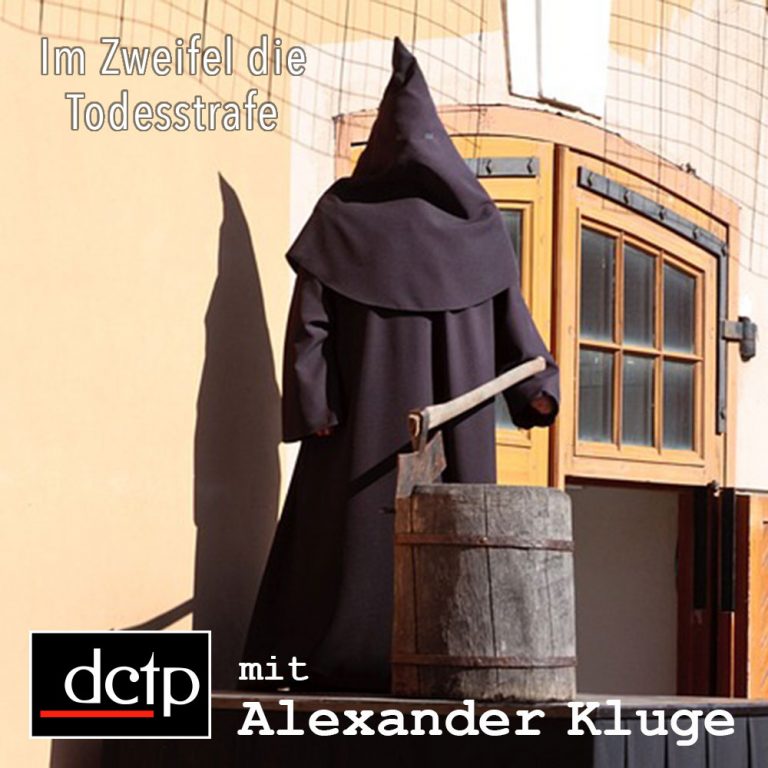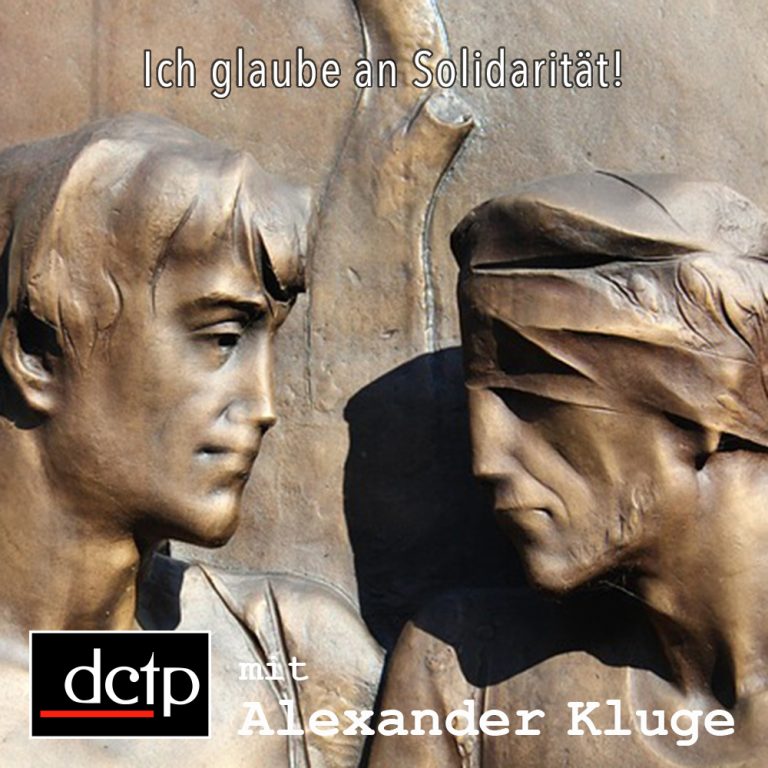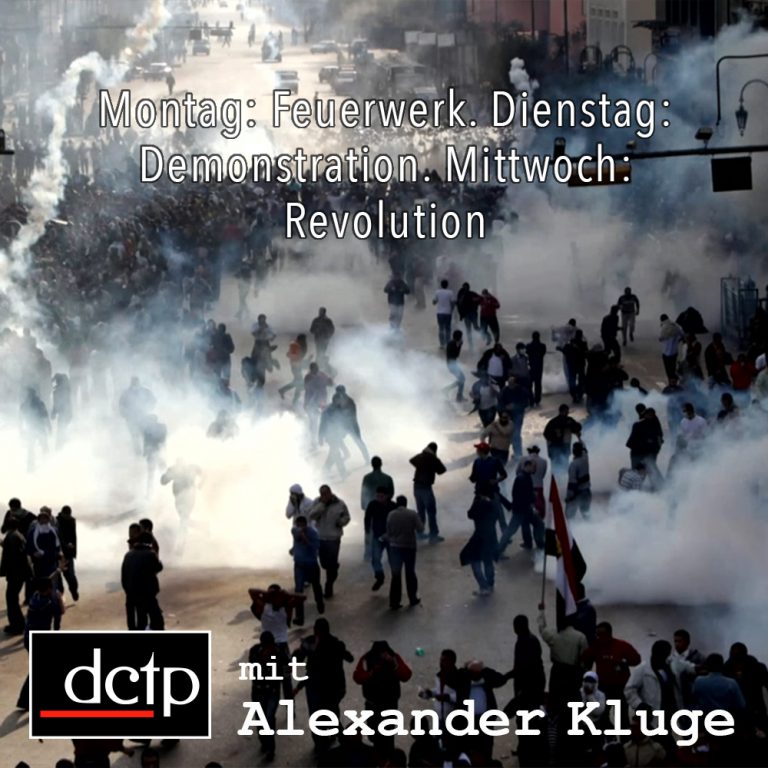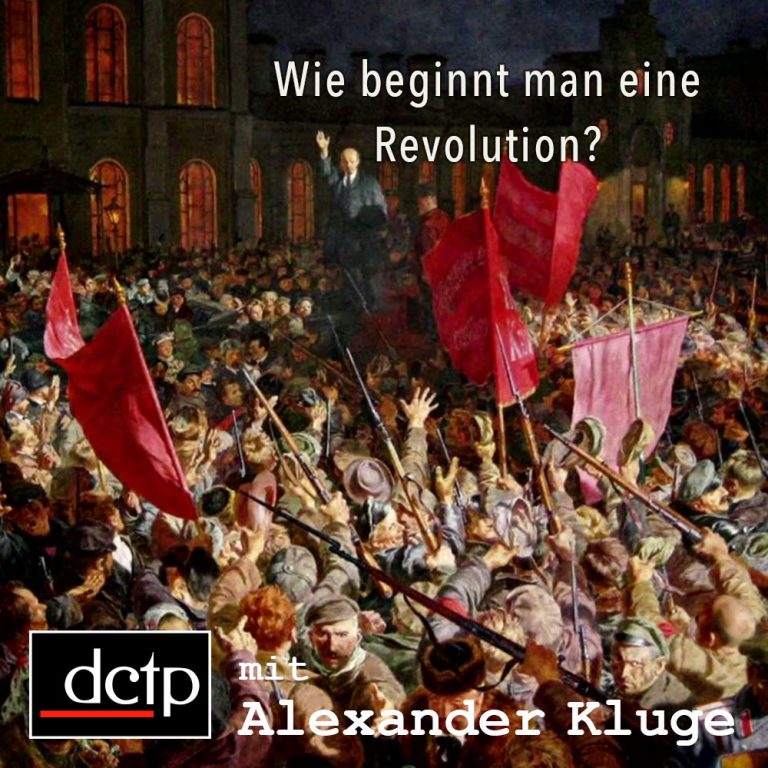
Wie beginnt eine Revolution?
Der Dichter und Kritiker Ludwig Tieck beobachtete in London hungrige Proletarier, die er mit Wölfen verglich. Sie strichen durch die nächtlichen Ladenstraßen der Stadt, nur durch dünne Ladenfenster von den üppigen Delikatessen getrennt, die ihren Hunger gestillt hätten. Tieck wunderte sich, dass das dünne Glas, das ein einziger Stein hätte zerstören können, diese Menschen abhielt, die gesellschaftliche Ordnung zu brechen. Es muss eine Mauer in ihnen geben, die sie vom Übergriff abhält.
In welchen historischen Momenten Revolutionen beginnen, ist nach wie vor unerforschtes Gebiet. Die frühen Revolutionäre wie Georg Weerth hielten den Streik für den Anfang des modernen Widerstands. Später galten Barrikadenkämpfe als Auslöser für den Umbruch. Was ist das revolutionäre Subjekt? Die Vorgänger der kommunistischen Partei, jene Gruppe von Wilhelm Weitling, für die Karl Marx und Friedrich Engels das Kommunistische Manifest schrieben, nannte sich „Bund der Gerechten“. Für die frühen Revolutionäre war die Frage wichtig: „Nehmen wir an, die Revolution würde heute stattfinden, wie geht es morgen weiter?“
Der Historiker Dr. Patrick Eiden-Offe, Zentrum für Literatur-und-Kulturforschung Berlin, über das revolutionäre Subjekt und die Frage: Wie beginnt eine Revolution?