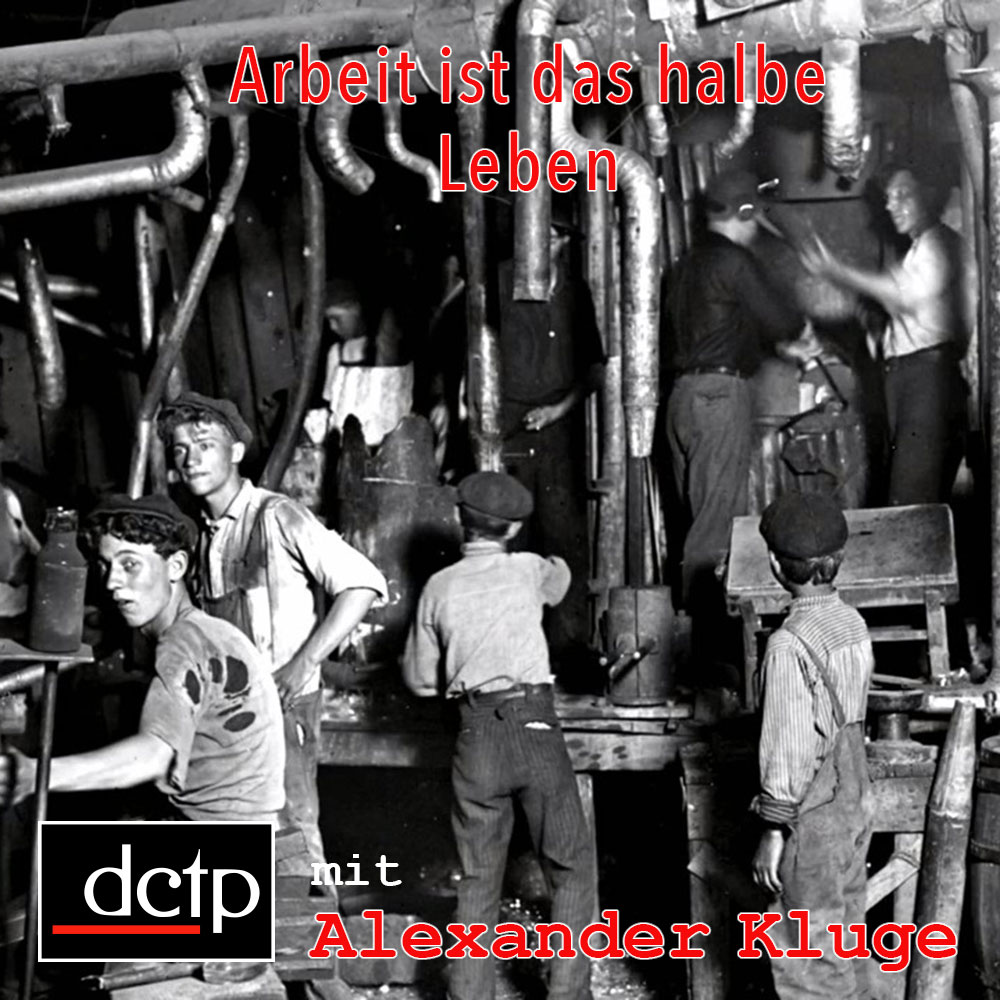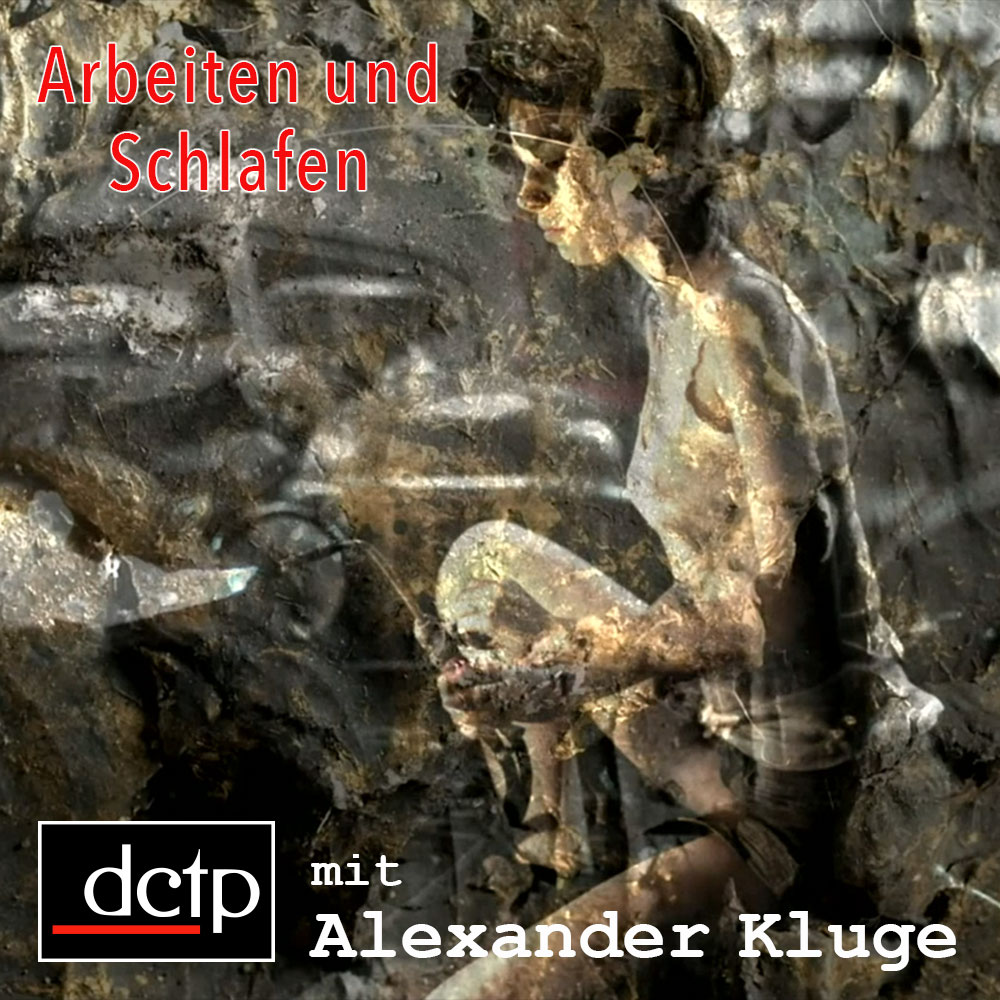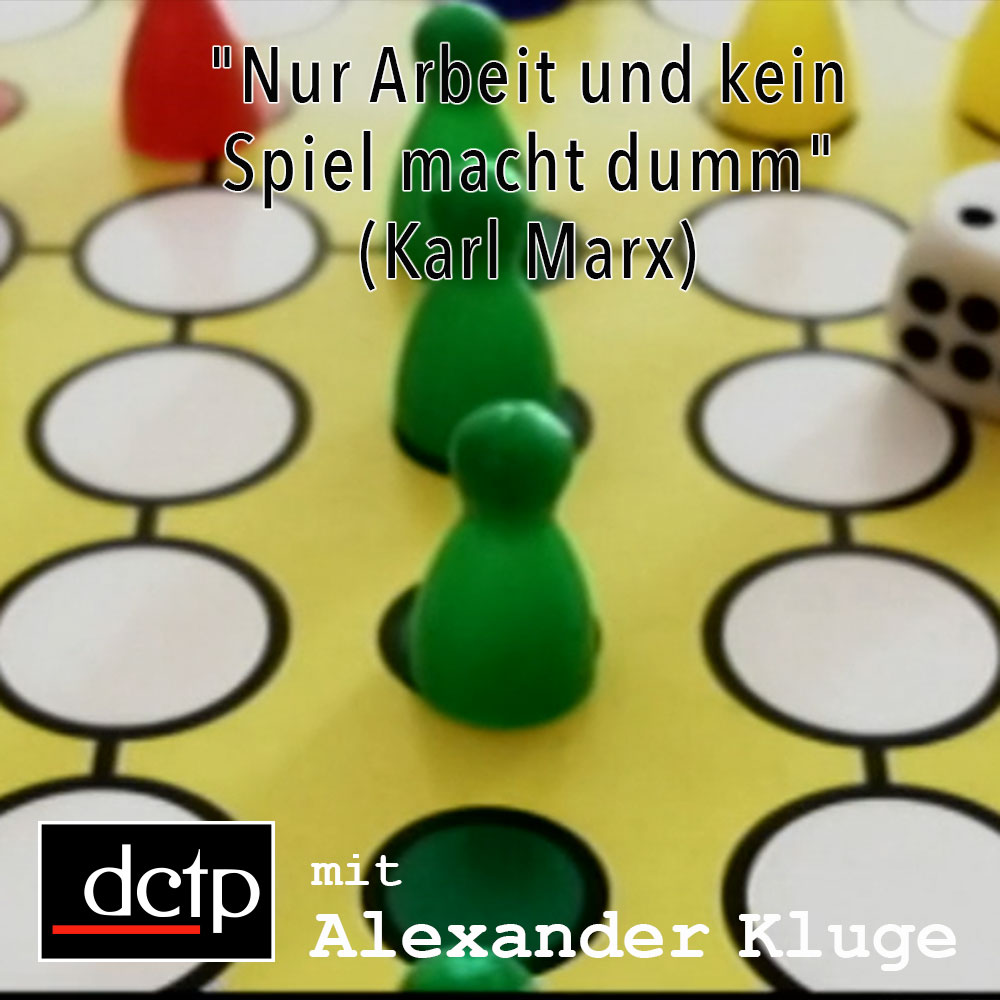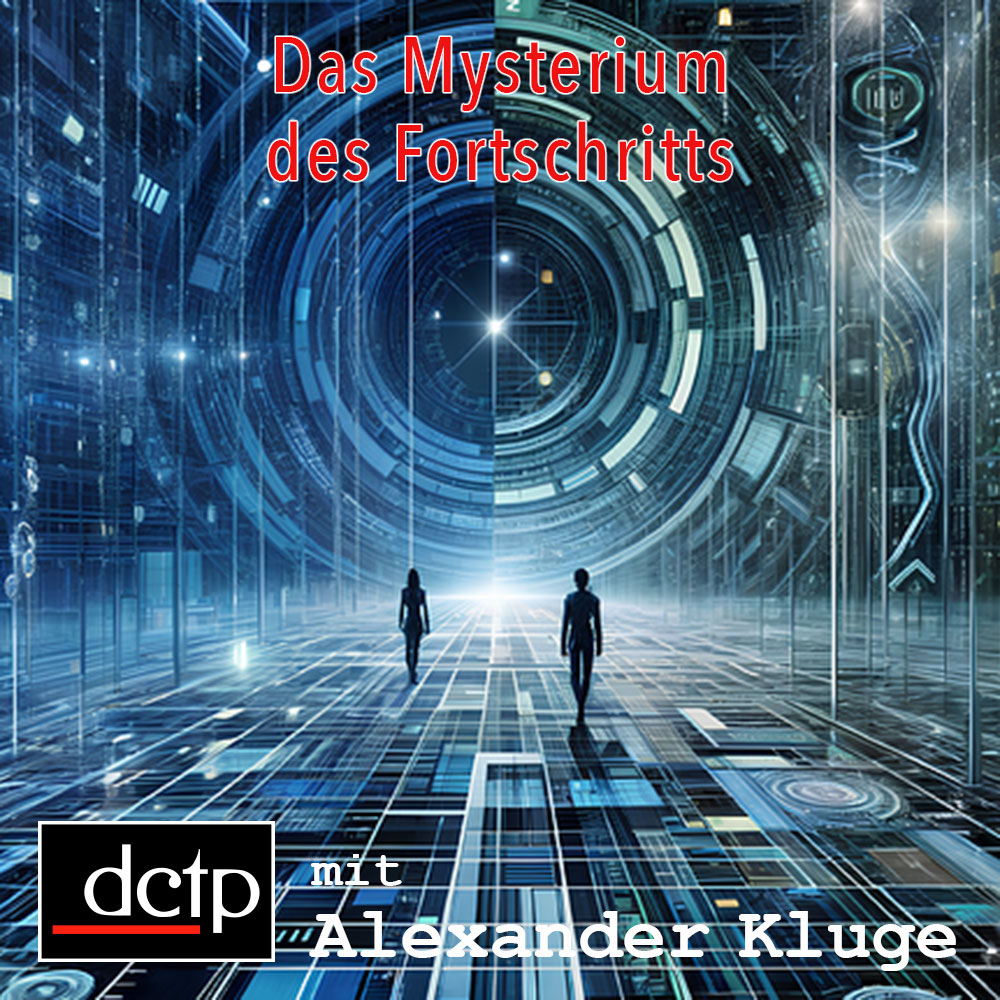Die Digitalisierung verändert die Gesellschaft, die Ökonomie und darin sowohl die Produktion als auch den Konsum. Man nennt das die vierte Industrielle Revolution. Von der Dampfmaschine und der ersten Industriellen Revolution hergesehen, gewiss ein Umbruch.
Diese Umwälzung bringt auch Veränderungen im Inneren der Menschen hervor: den Mensch 4.0. Der Soziologe Dirk Baecker zeigt aber, dass dabei, zumindest auf dieser subjektiven Seite, der des Menschen und seiner Kommunikation, alle früheren Stufen der Entwicklung erhaltenbleiben: “Zur Gegenwart gehören alle Zeiten”.
Dirk Baecker unterscheidet dabei vier Stufen:
1. Die Stammesgesellschaft, hier gilt das “Prinzip Mündlichkeit”. Kinder wachsen heute noch immer so auf.
2. Die Welt der Antike hier setzte sich das “Prinzip Schriftlichkeit” durch. “Was gilt, muss zu lesen sein”.
3. Die Welt der Renaissance. Die Massenproduktion an Druckerzeugnissen von Gutenberg gehört in diese Epoche.
4. Die Digitalisierung. Sie prägt unsere Gegenwart, aber sie kann keine der früheren Stufen entbehren.
Digitalisierung und die sogenannte Disruption zerstört ganze Märkte und Wirklichkeiten und sie bringt neue hervor. Starke Auswirkungen hat sie auf die Zukunft der Arbeit. Aus dem Bild traditioneller Berufe rückt zumindest in den Industrieländern, die Arbeit heraus. Sie wird projektbezogen, entfesselt und in die Wüste der Flexibilisierung entlassen. Sie verändert auch die Stellung der Chefs. Sie werden von klassischen Entscheidern zu “Ermöglichern”, die in der Pyramide keine Spitze mehr bilden, sondern die Türme der Arbeit umkreisen. Wo finden dann die Entscheidungen statt? Bisher haben nur Demagogen (falsche) Antworten auf diese Fragen.
Auch in der Vergangenheit konnte Arbeit zerstörerisch (z.B. im Krieg und in Schumpeters “Schöpferischer Zerstörung”) oder produktiv sein (in der Entwicklung immer neuer Technologien). Heute wird der menschliche Wille (und damit auch große Teile des “guten Willens”) von der Arbeit und der Realität abgekoppelt. Das ist für den Mensch 4.0 verwirrend. Es ist aber beruhigend, wenn Dirk Baecker, der bedeutendste Vertreter aus der soziologischen Schule von Niklas Luhman, mit guten Beispielen darauf hinweist, dass alle übrigen Zeiten (und ihre seelischen Strukturen) in unserer Gegenwart mitwirken. Nur in der Renaissance gibt es ähnlich viele Wirklichkeiten, die bei der Herstellung von Gegenwart miteinander ringen.