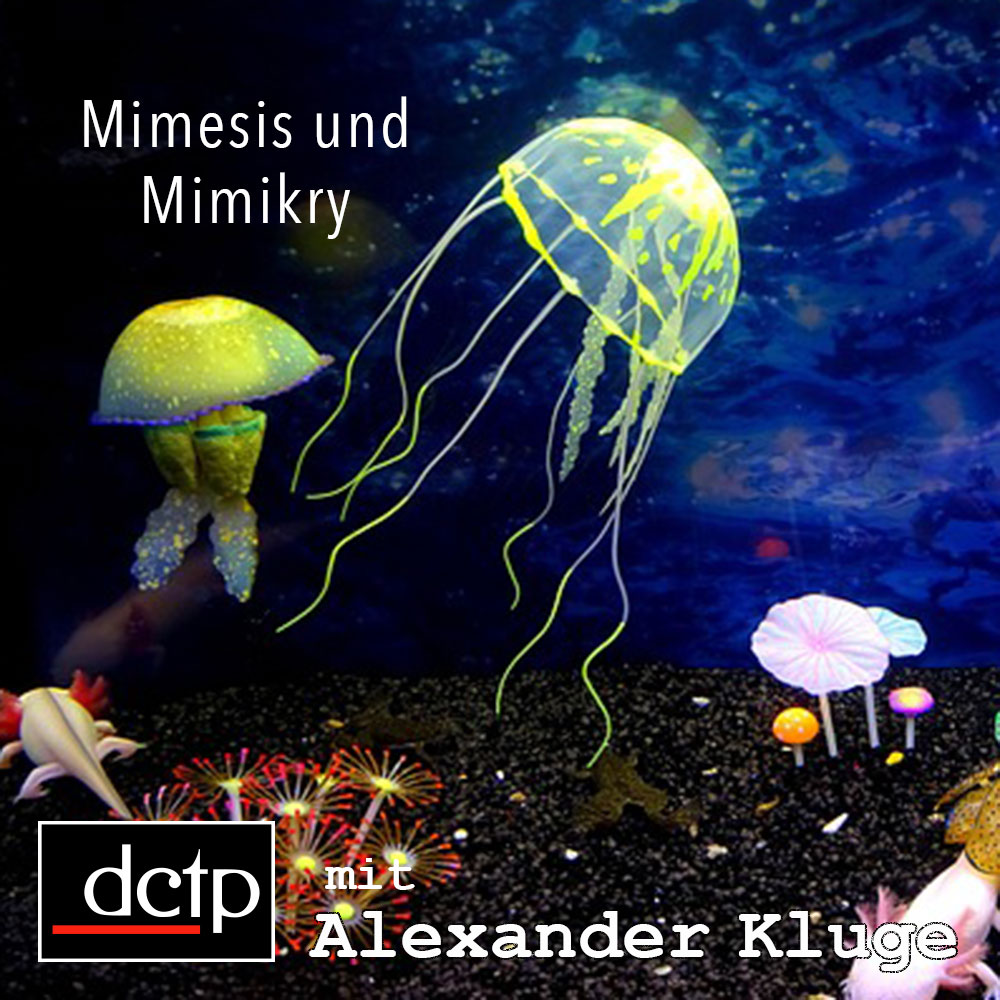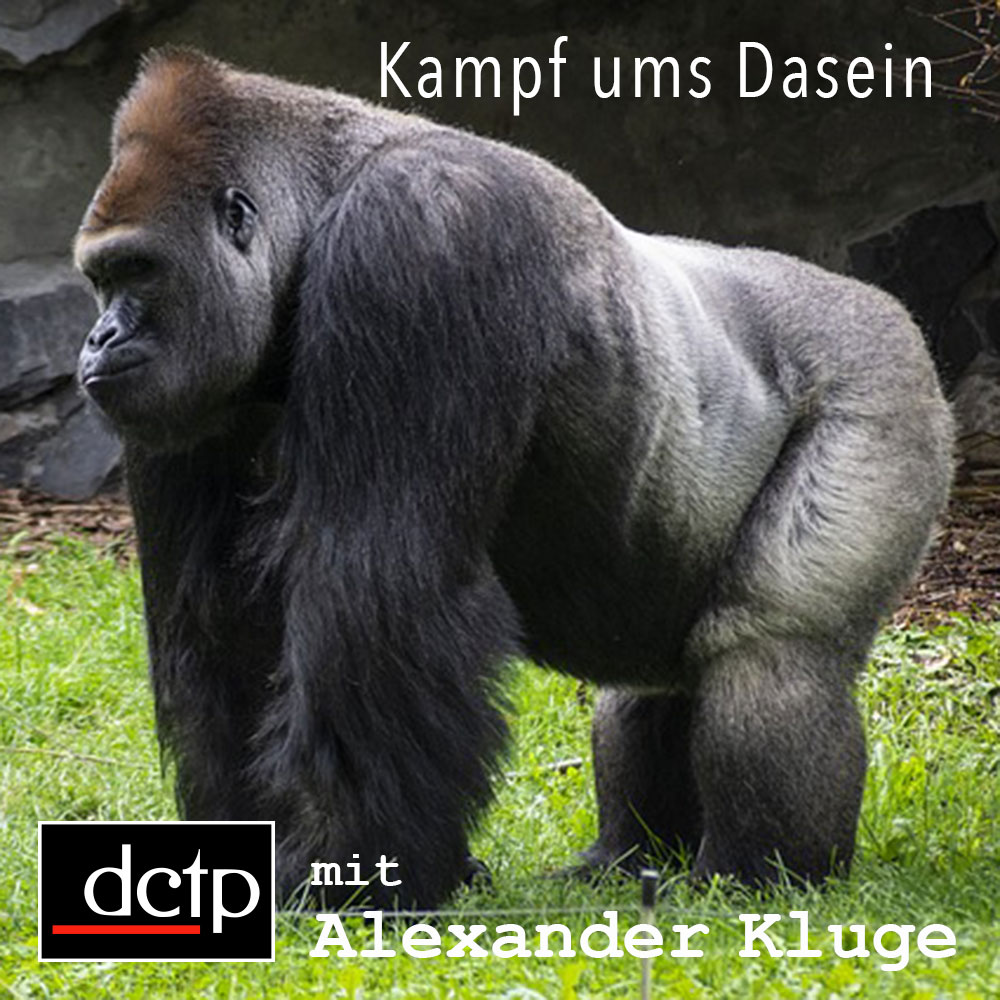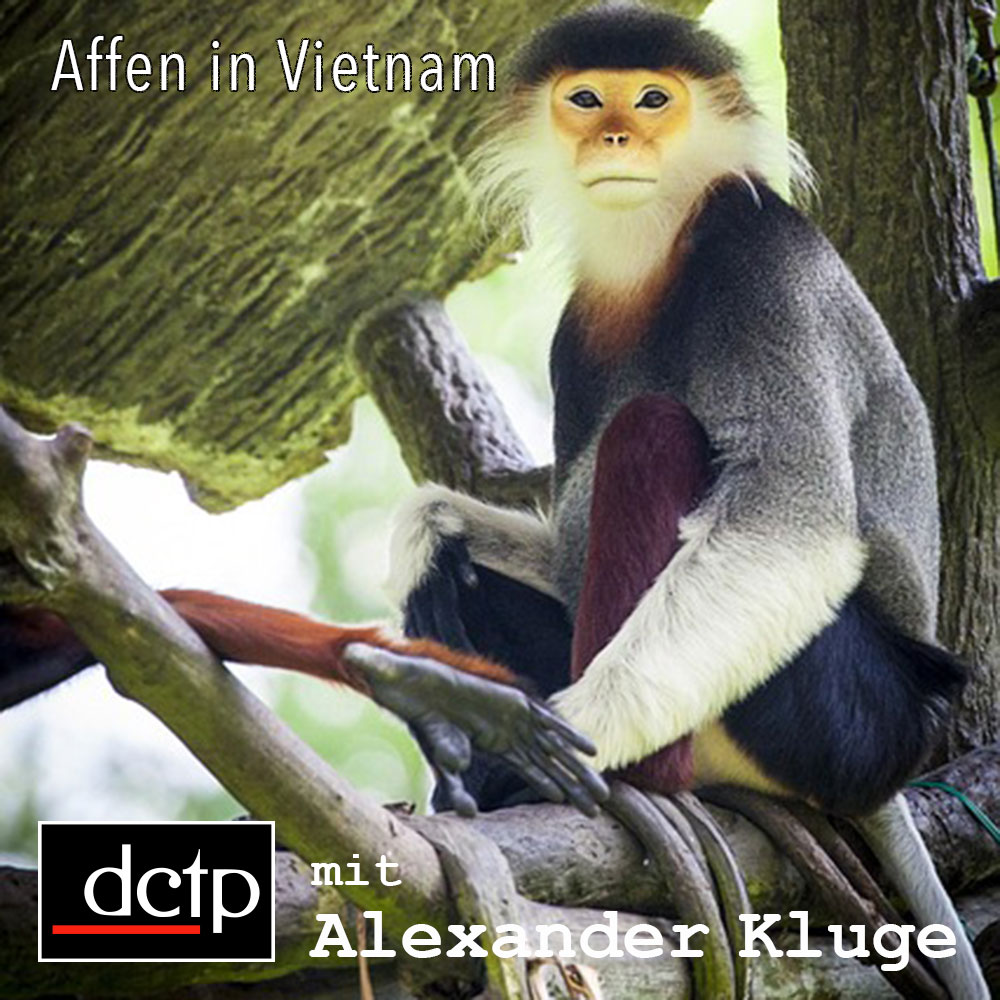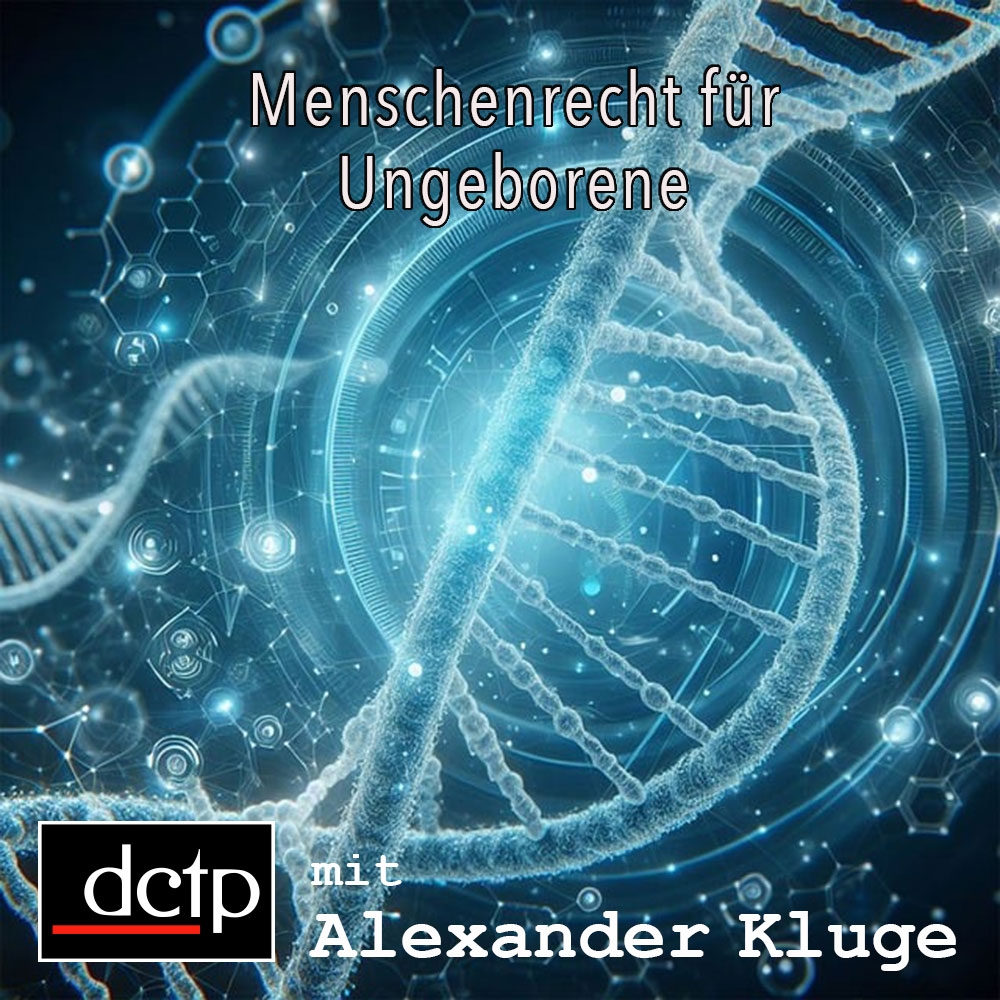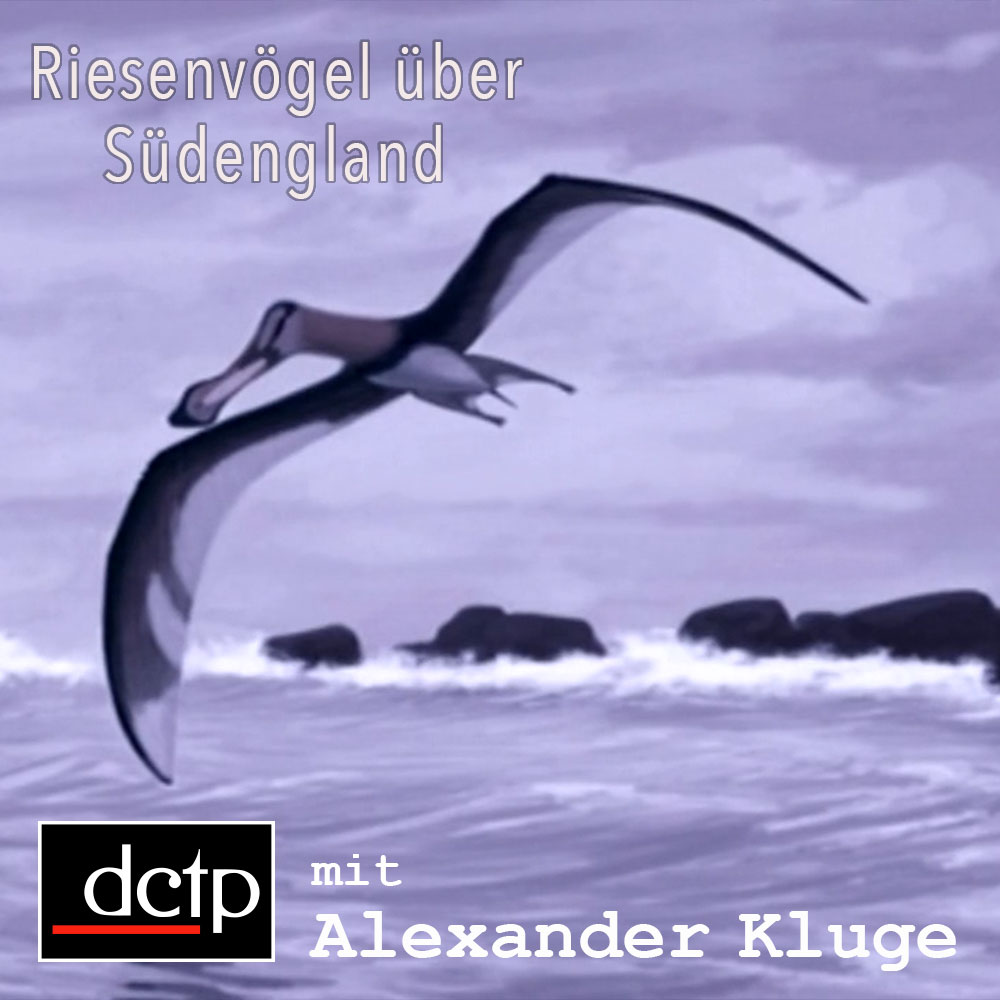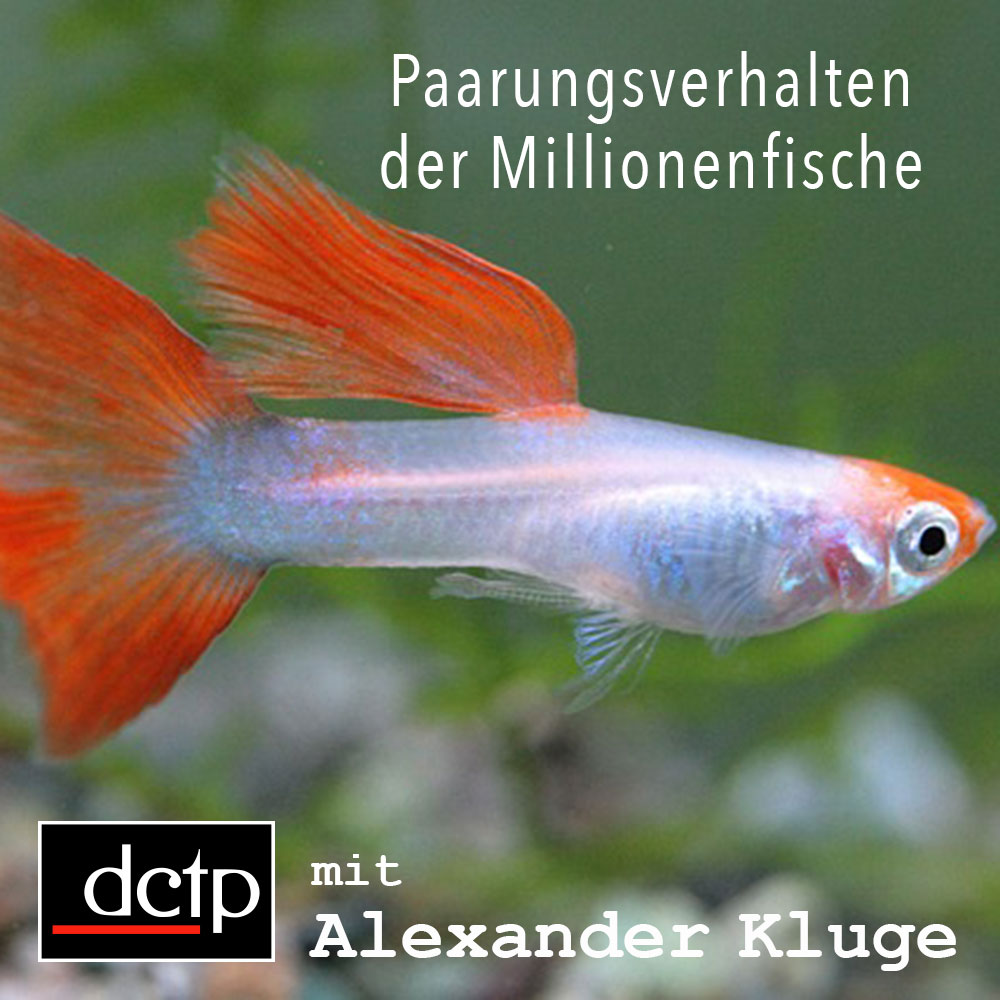
Paarungsverhalten der Millionenfische
Ein karpfenartiger Fisch, den es im Atlantik ebenso gibt wie im Süßwasser und der sich rasch vermehrt und eine interessante Vielfalt an sexuellen Präferenzen zeigt, wird „Millionenfisch“ genannt. An ihm studieren die Evolutionsbiologen gern die Varianten des Paarungsverhaltens. Sie sind verblüfft darüber, dass weibliche Exemplare, nachdem sie den Zweikampf zwischen zwei Männchen um ihre Gunst beobachtet haben, zunächst oft den Besiegten bevorzugen.
Die Biologen führen das darauf zurück, dass sie den aufgemotzten und im Kampf erregten Sieger als Gewalttäter fürchten. Eine Zeit später legt sich der Impuls und sie kehren zu der Präferenz für den Stärkeren zurück. Das lässt sich alles mit Darwins Thesen vereinbaren, dass die Evolution Wege verfolgt, die für eine reiche Nachkommenschaft günstig sind. Wie aber ist die Homosexualität unter den Fischen zu verstehen? Sie bringt keine Nachkommen. Offenbar hat sie aber ebenfalls evolutionäre Vorteile.
Dies alles gehört zum Forschungsgebiet des Evolutionsbiologen Privatdozent Dr. Martin Plath, Universität Frankfurt.