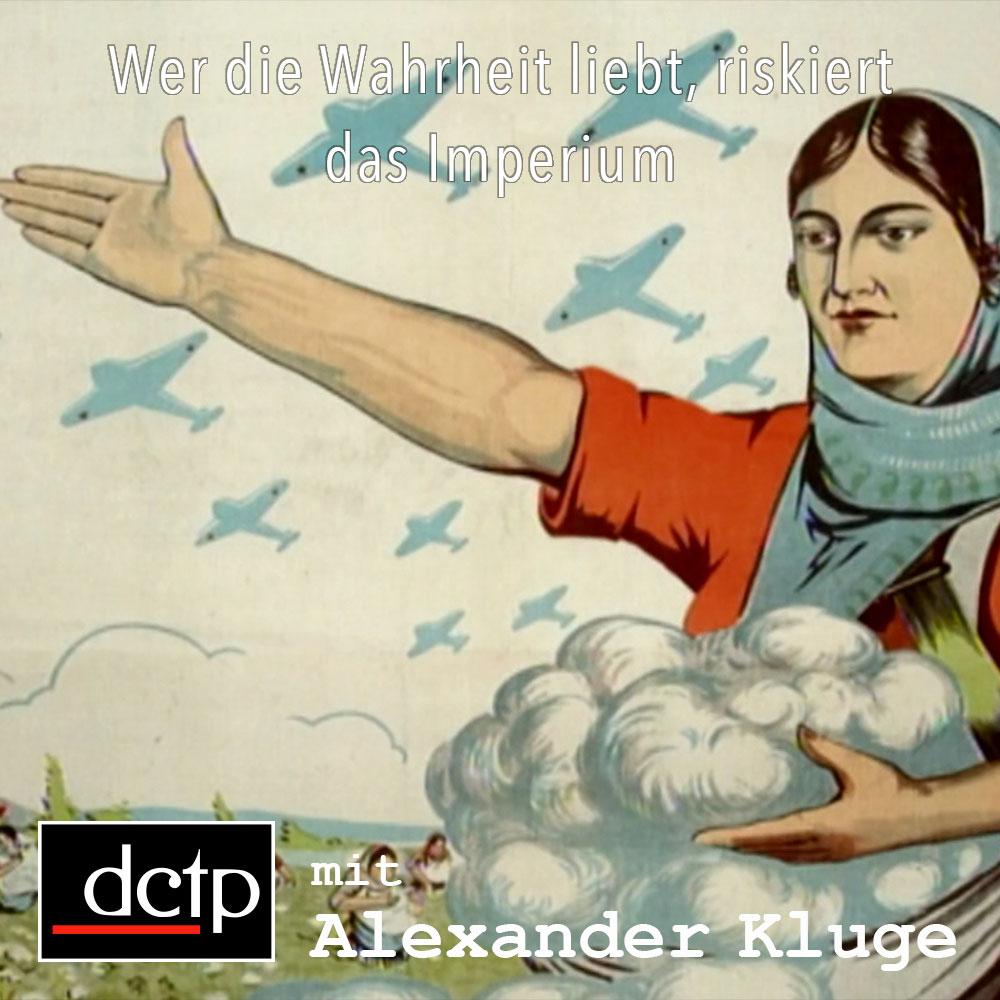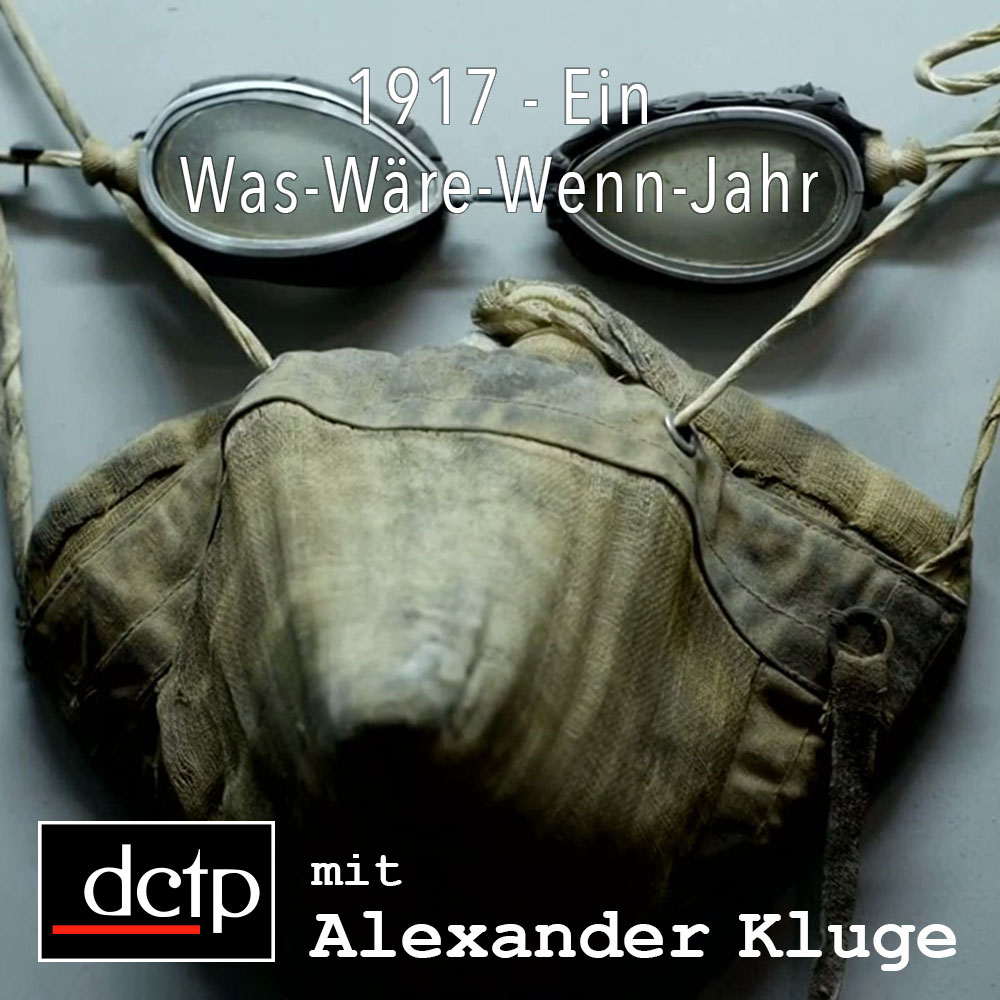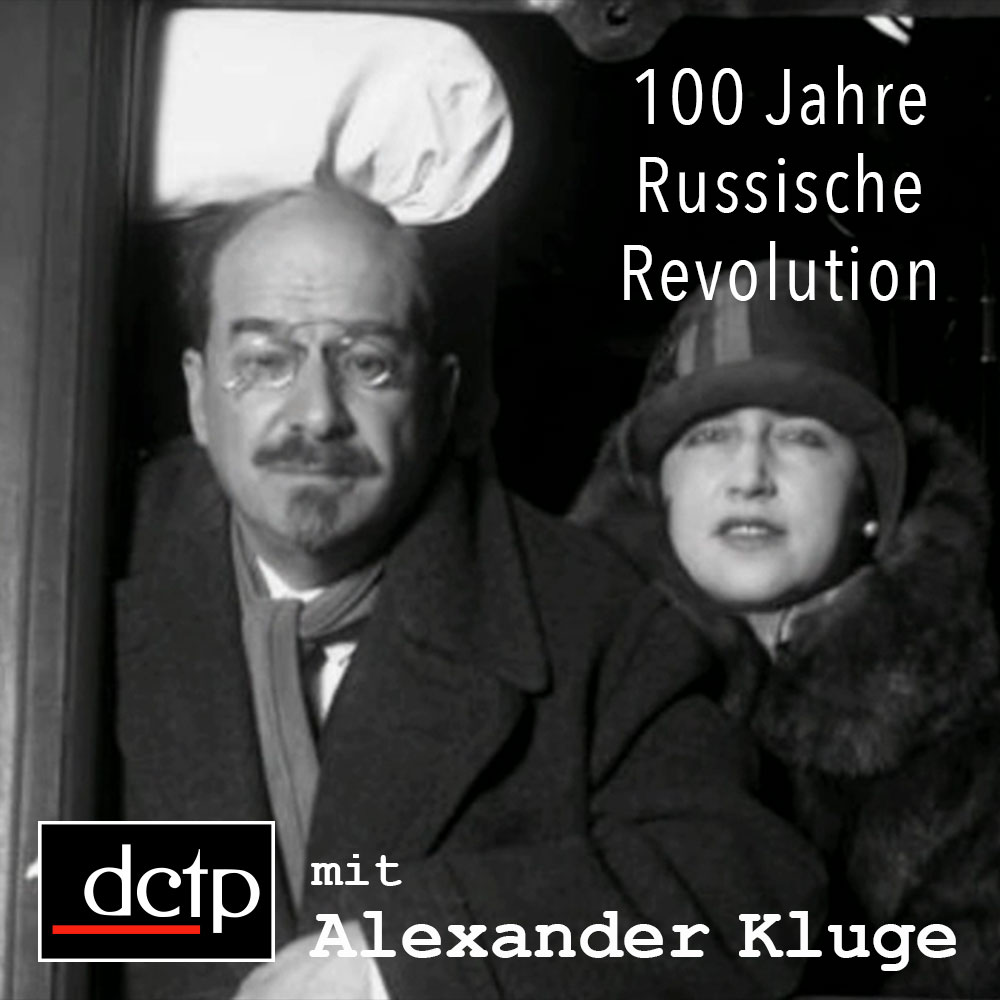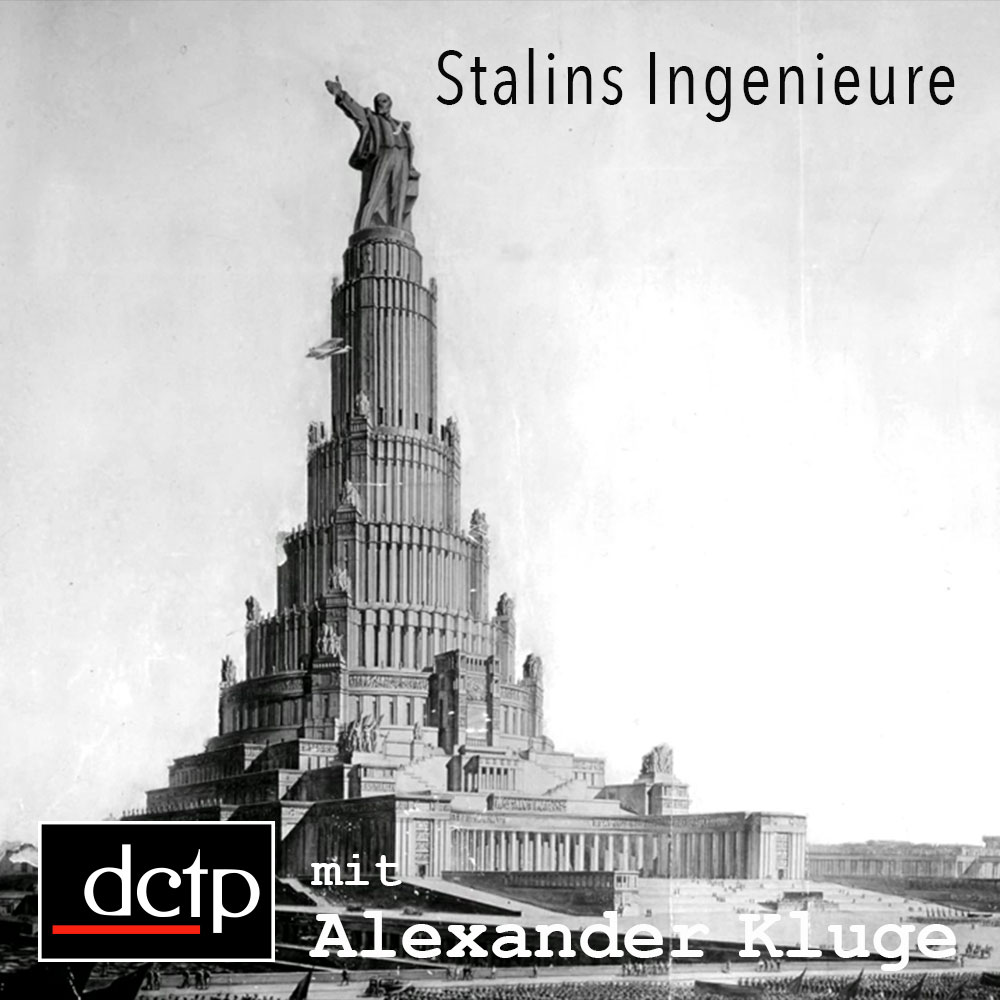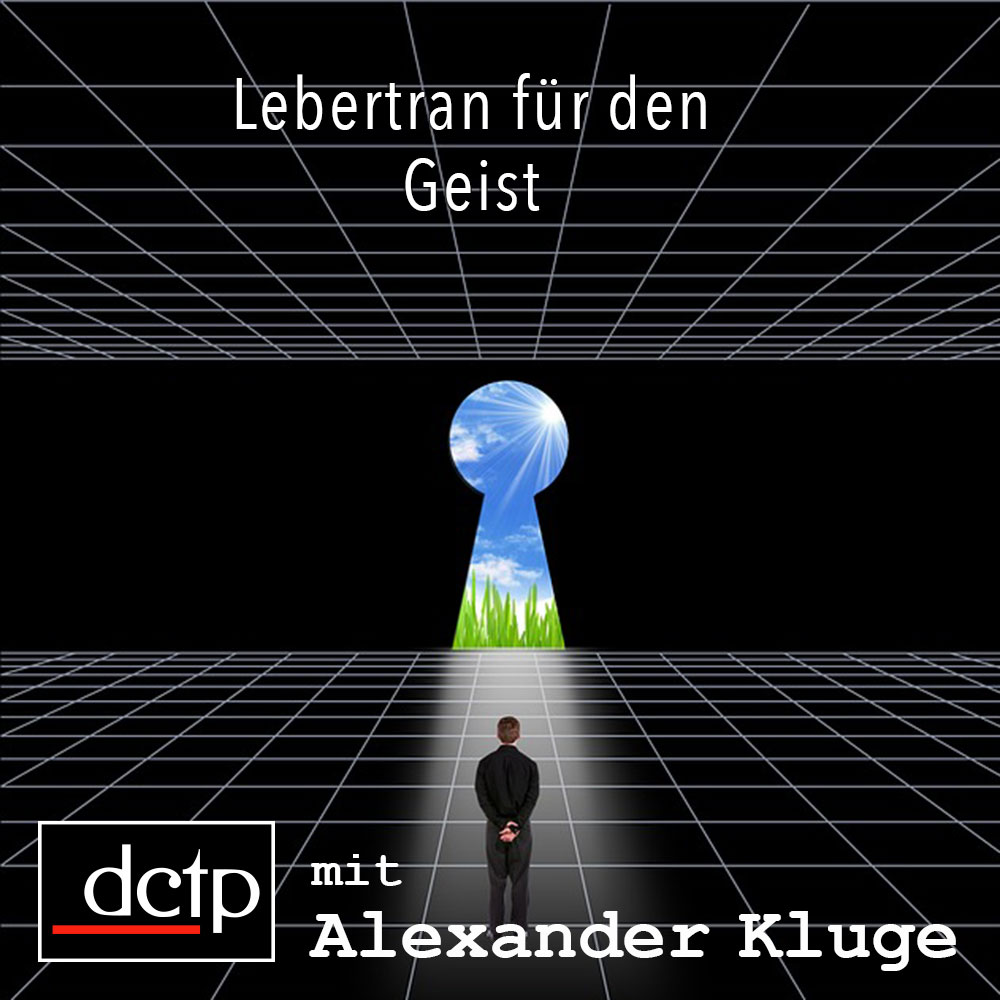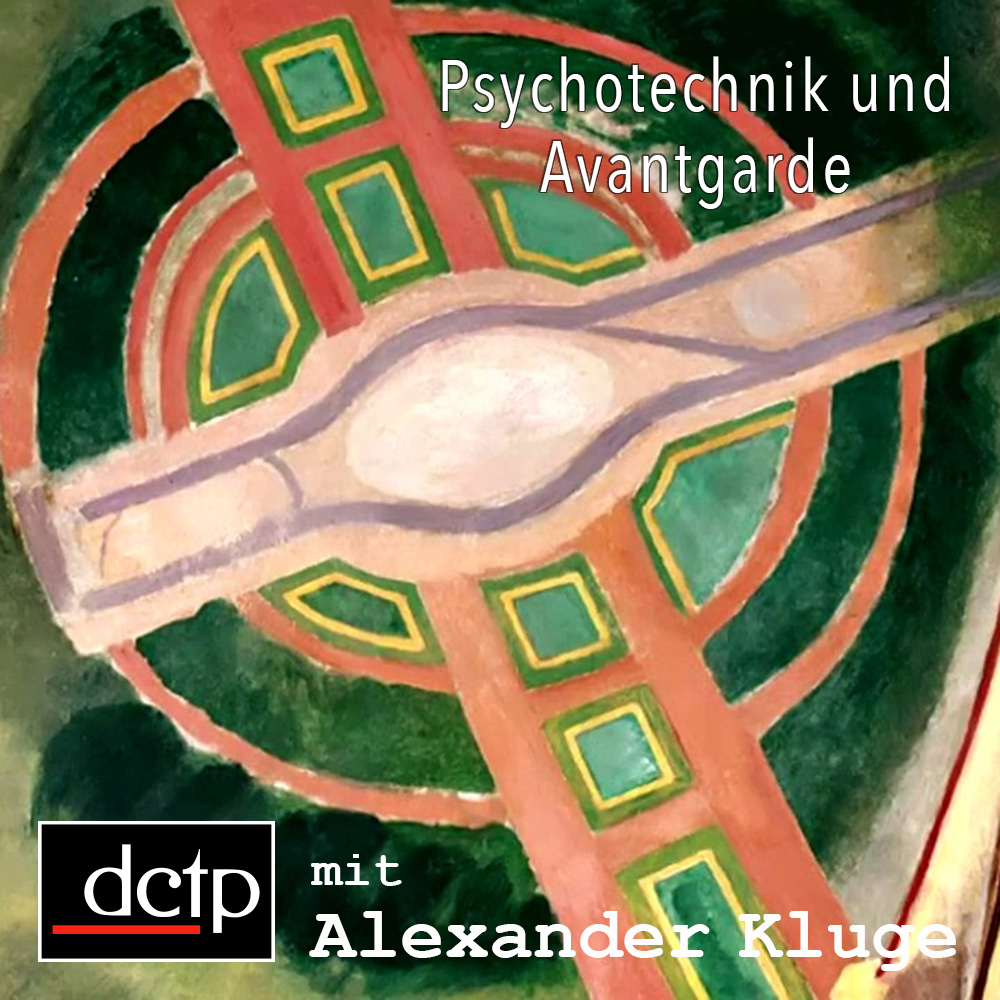Ein dynamisch in Entwicklung befindliches Gebiet der Geschichtswissenschaften ist die Emotionsgeschichte. Die Gefühle und ihre Benennungen, auch ihre Dominanzen, haben ein Eigenleben. Zorn, Autorität, Werte wechseln in jeder Generation ihre Bedeutung. Dies ist von großer Wichtigkeit, wenn man den Stalin-Kult und den Führer-Kult, also gesellschaftliche Artefakte der Propaganda, untersucht, in die – auch wenn diese Bilder künstlich hergestellt wurden und man den Mechanismus analysiert – gewaltige emotionale Bindungen der Menschen selber eingegangen sind.
Prof. Dr. Jan Plamper, Historiker an der University of London und Fellow am Wissenschaftskolleg zu Berlin, hat diese Zusammenhänge in seinem Buch über den Stalin-Kult dargestellt. Er vergleicht darin auch die andersgelagerten, aber ebenso aus politischer Absicht von oben und emotionaler Bindung von unten entstandenen Kulte um Adolf Hitler und den Duce Mussolini, wiederum bei genauer Betrachtung zwei höchst verschiedene gesellschaftliche Produkte.
Wer Stalin als Mensch tatsächlich war, ist nicht mehr festzustellen. Seine Taten, die Propagandamaschine und die mit der Stalin-Zeit verbundenen lebensgeschichtlichen Vorstellungen der Menschen haben den authentischen Mann vollständig überlagert. Er selbst hat offenbar diese Differenz gesehen. Als er einen seiner Söhne betrunken vorfindet und ihn zurechtweist, weil er sich bei seiner Festnahme auf den Namen Stalin berief, sagt der Diktator: “Nicht einmal ich bin Stalin”.
Begegnung mit dem Historiker Dr. Jan Plamper.