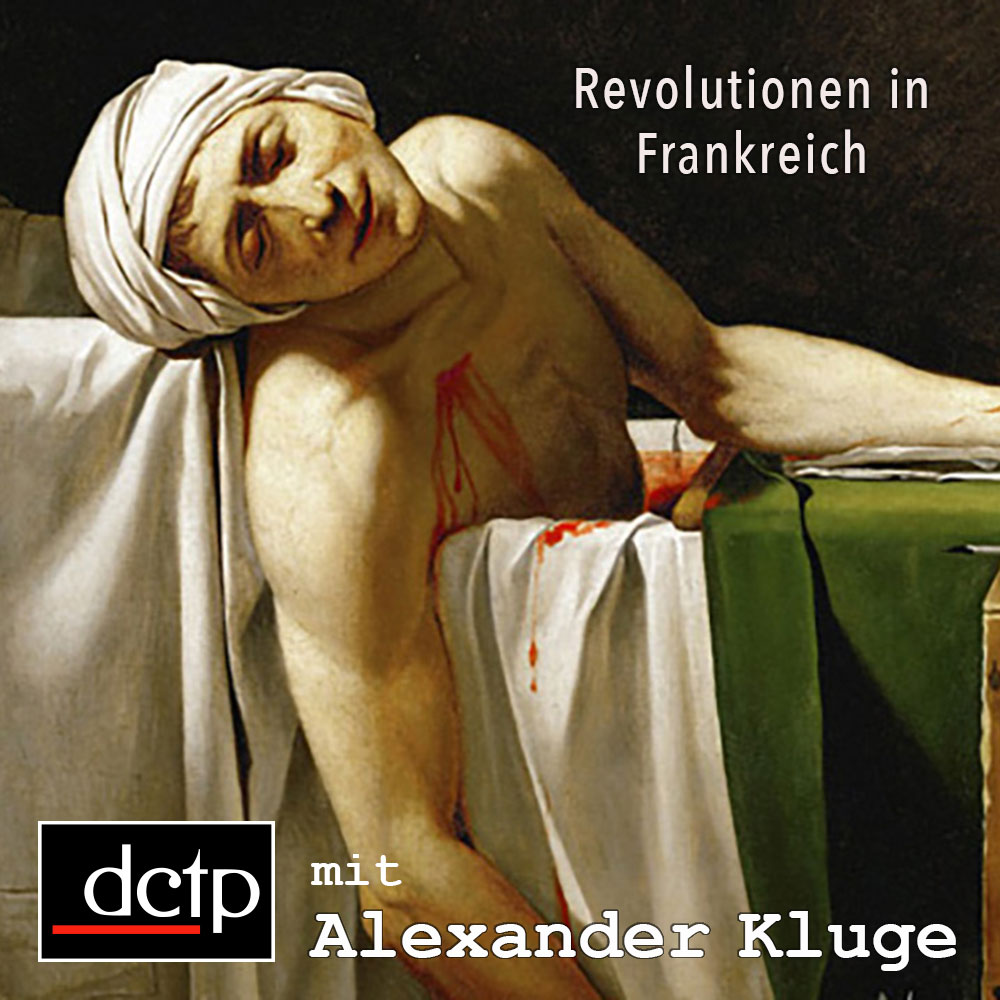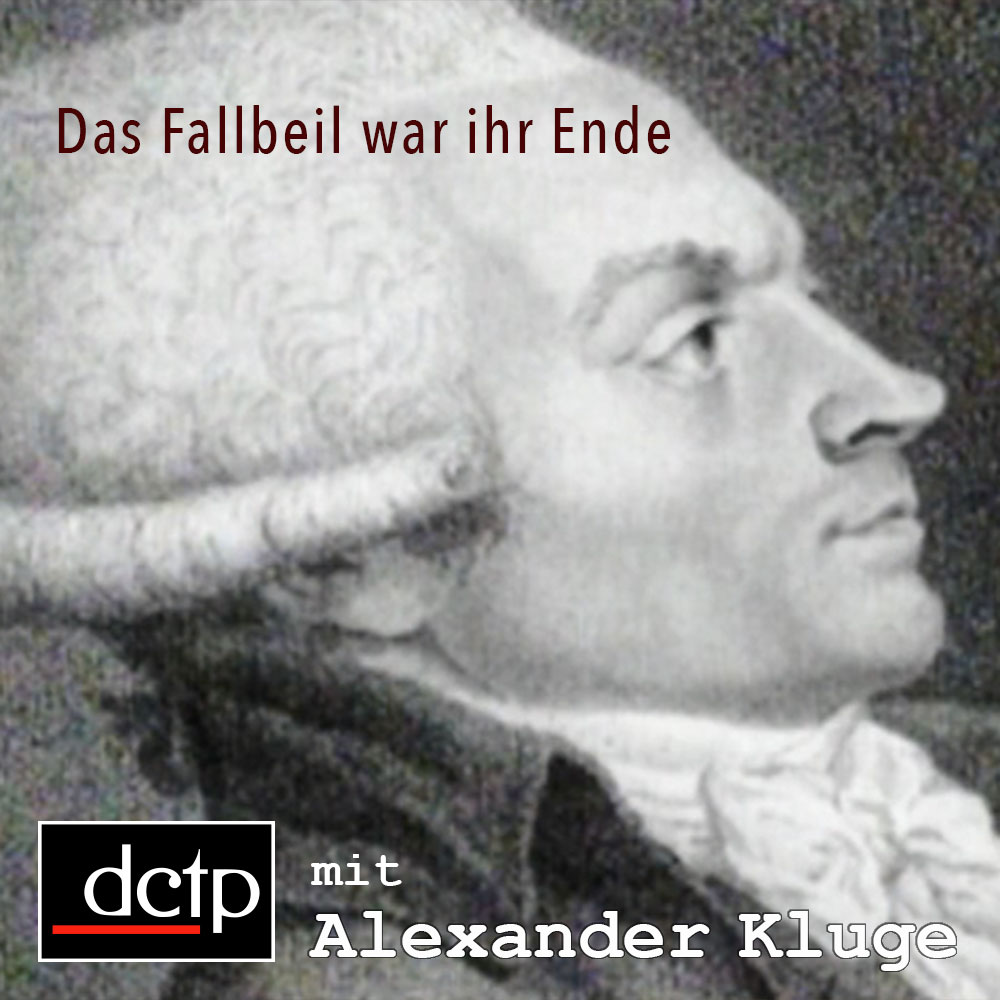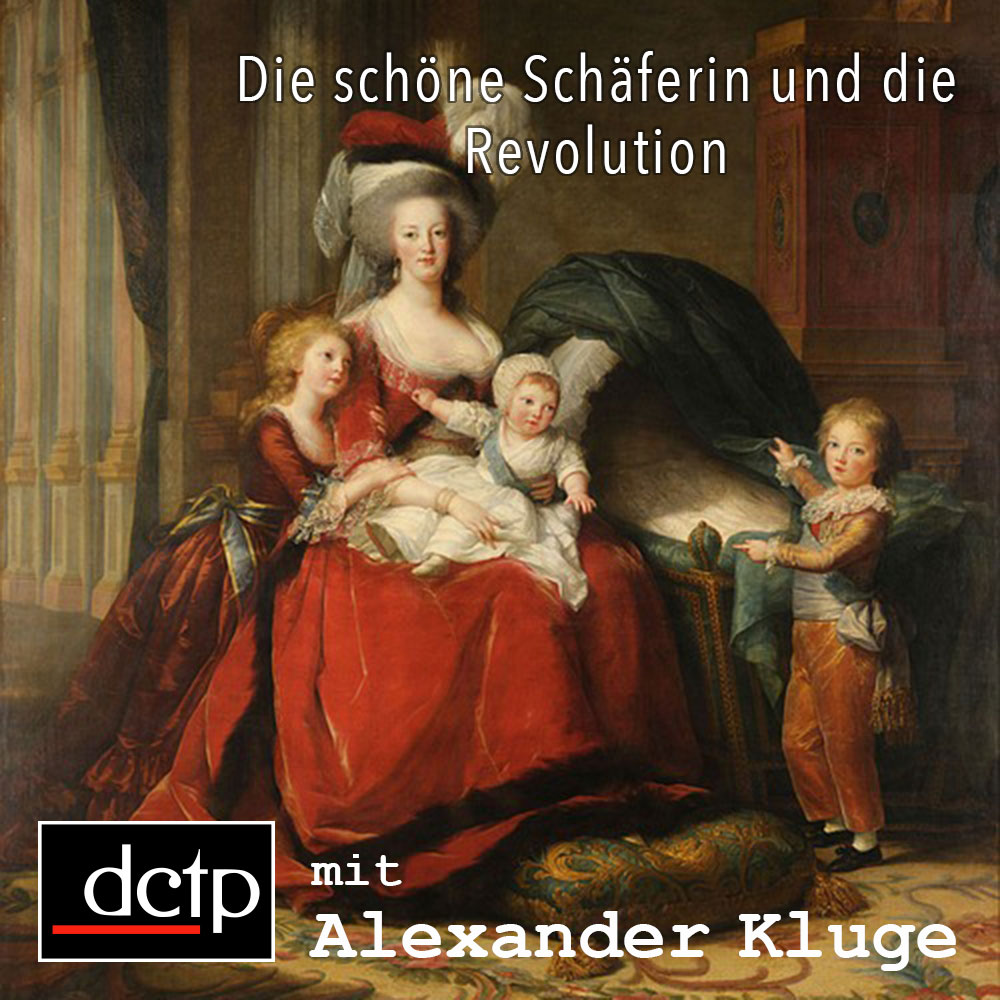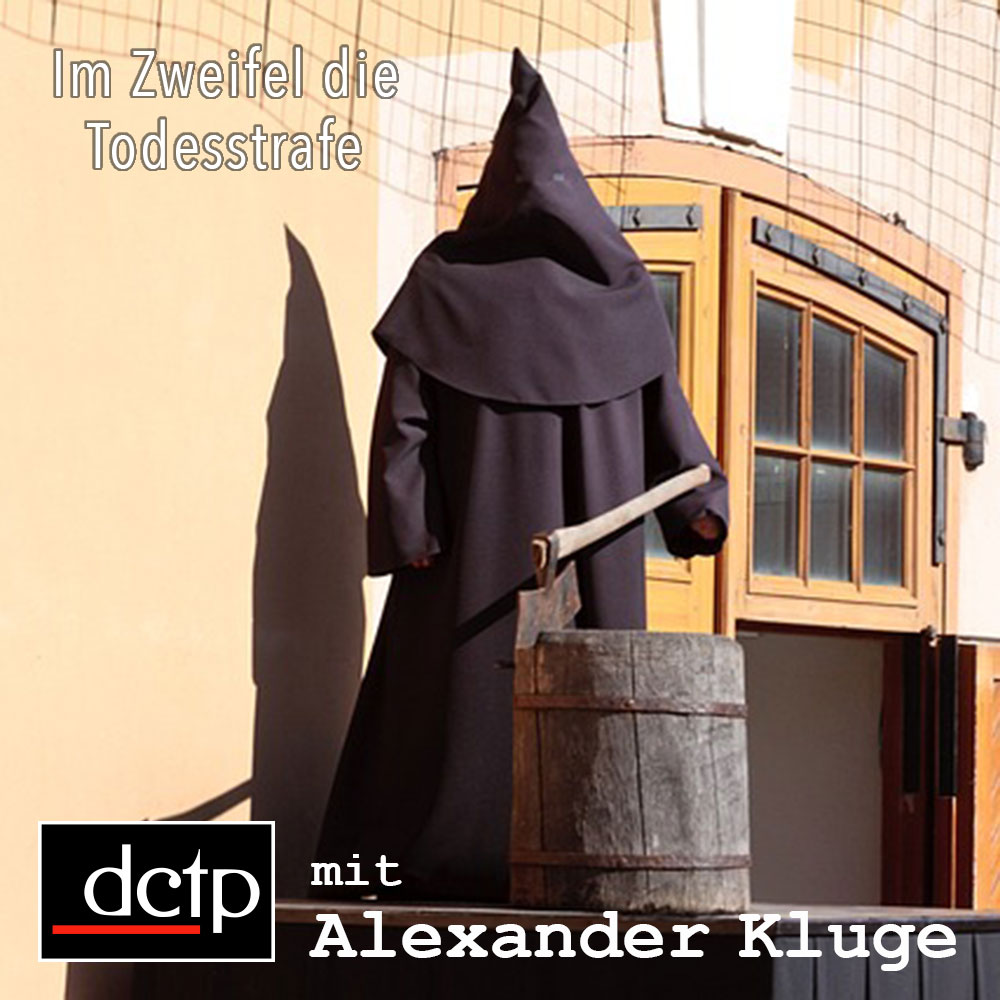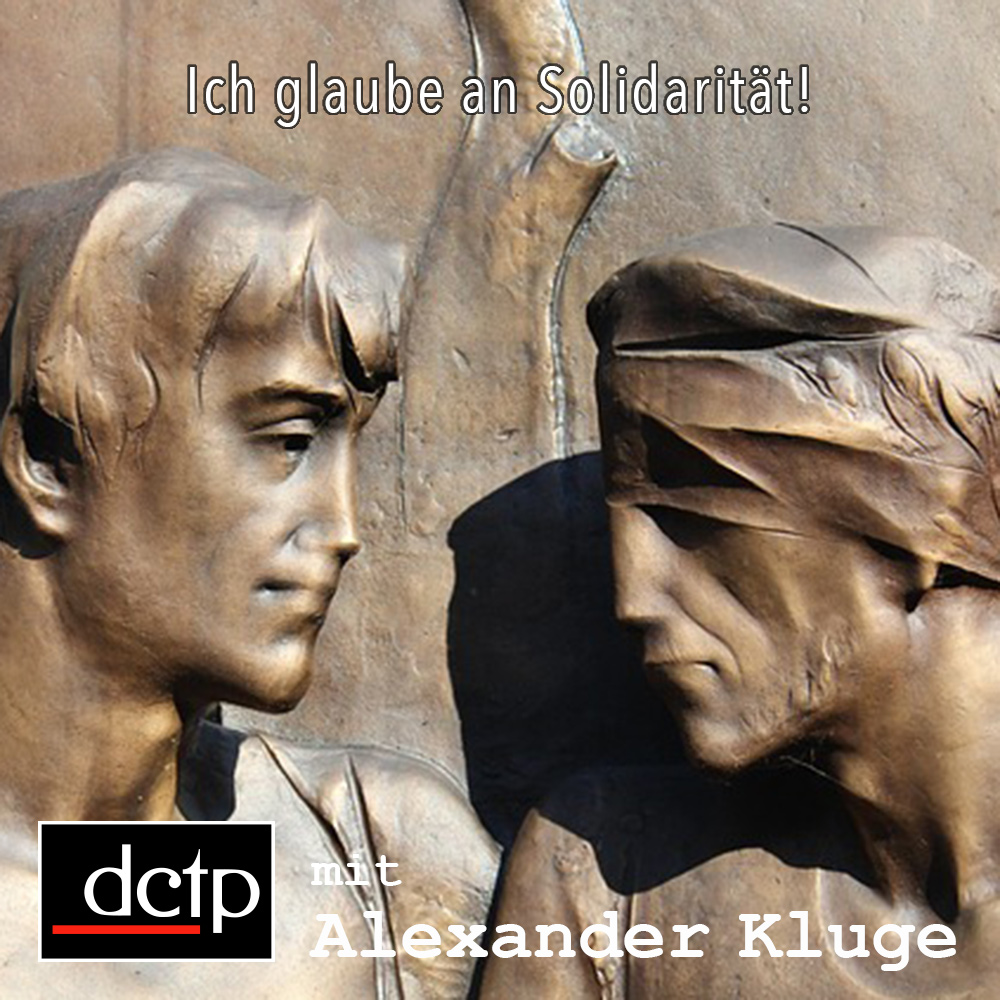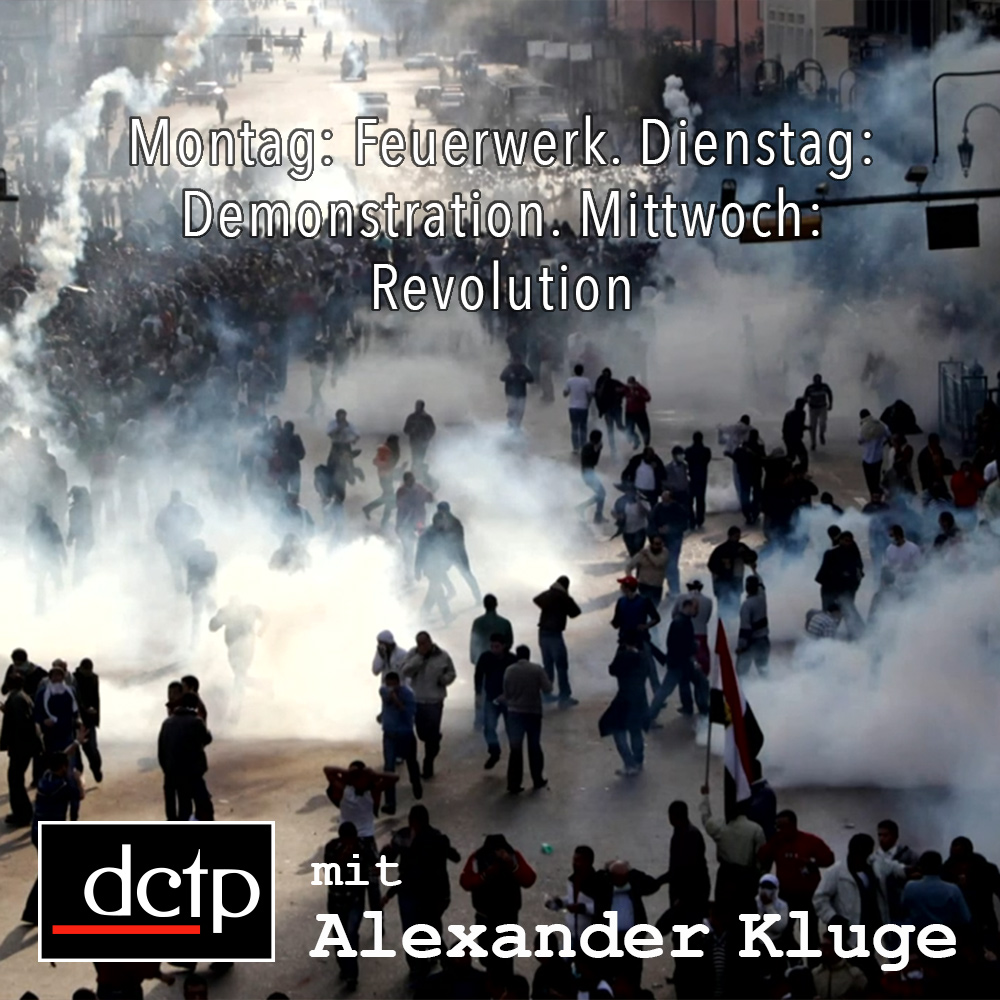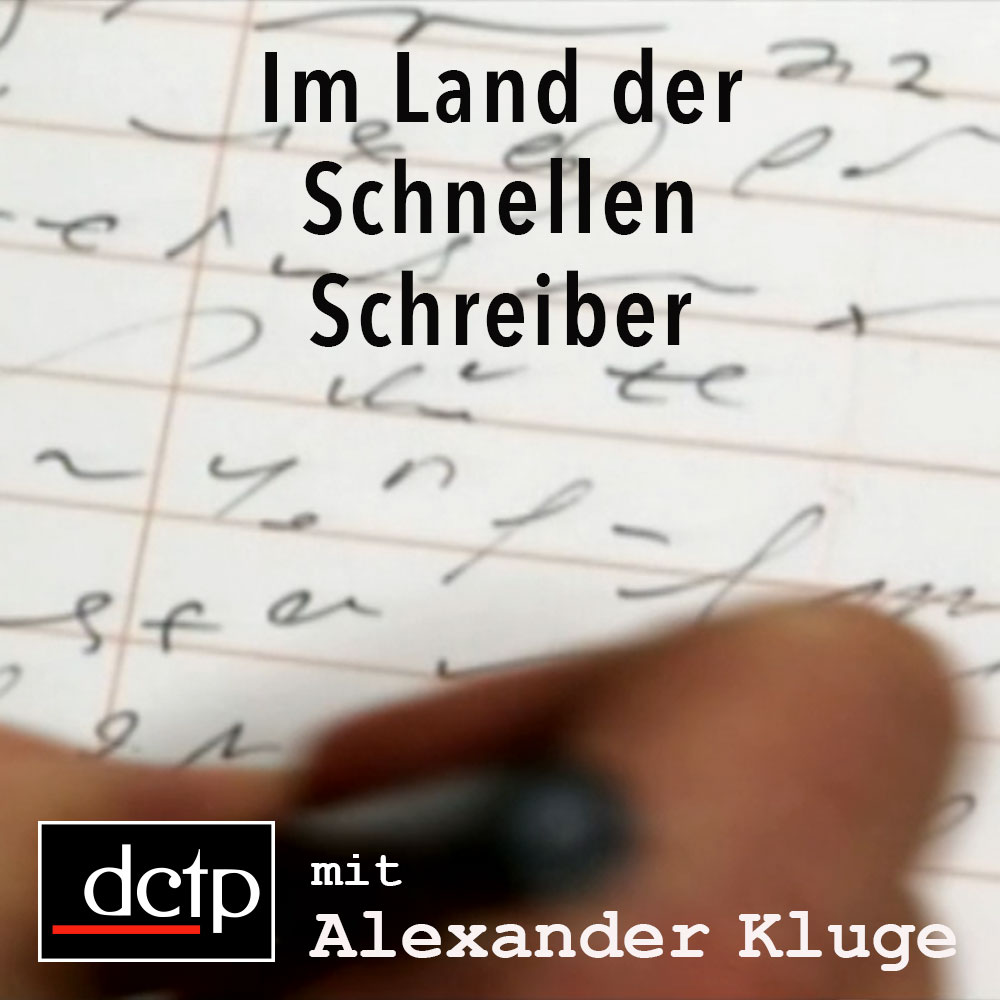Revolutionen in Frankreich
Der Autor Eric Hazan, Chef des renommierten Buchverlages LA FABRIQUE, schrieb zwei Bücher: “Die Geschichte der Französischen Revolution” und “Die Entstehung von Paris”. In dem Gespräch mit ihm geht es um die Frauen der Revolution, um die Barrikaden in Paris und die Verschiedenheit der Commune von 1871 gegenüber der Revolution von 1848, in der die Arbeiterklasse isoliert blieb und unterlag. Davon verschieden ist die Juli-Revolution von 1832 und die Großen Französischen Revolution von 1789. Die Kämpfe finden zu Anfang im Zentrum von Paris statt und gehen allmählich in den folgenden Revolutionen in die Peripherie, die Vorstädte, wo die Arbeiter wohnen. Die Erzählung von den Revolutionen ist fast immer überdeckt durch die nachträgliche Deutung durch diejenigen, die ihr nachfolgten. Wie Lava bedecken spätere Phrasen die Fundorte. So ist es, wie Eric Hazan betont, eine Phrase, dass in der Revolution von 1789 das Bürgertum die Feudalherrschaft ablöste. Der Adel war durch Könige wie Ludwig XIV längst entmachtet. In der französischen Sprache unterscheidet man deshalb den Bürger (le bourgeois) von den Gründern der neuen Republik (les citoyens). Die Revolutionäre der ersten Französischen Revolution waren besonders jung. Sie lassen sich in kein Klassenschema und in keine äußere Logik einfügen. Sie sind “enragés” und im revolutionären Moment “außer sich”. Begegnung mit Eric Hazan, dem besten Kenner von Paris und seiner Revolutionen seit Jules Michelet.