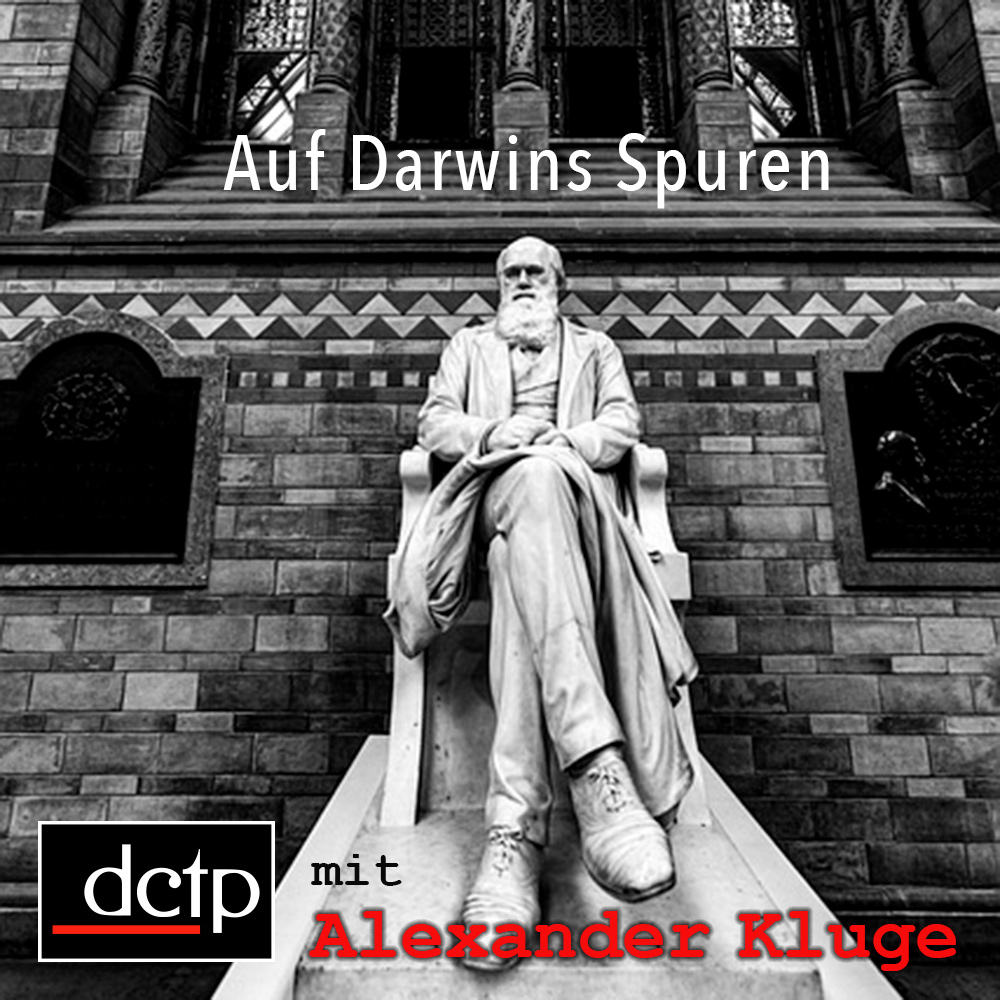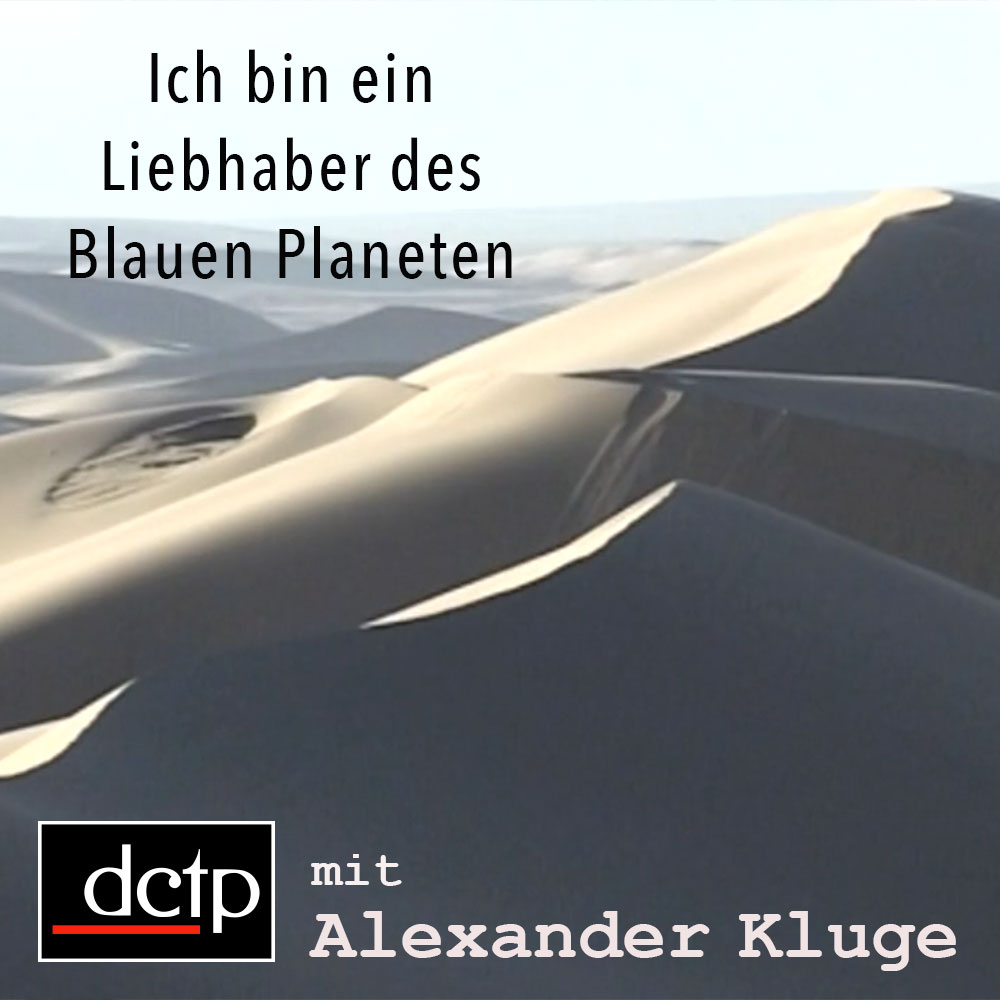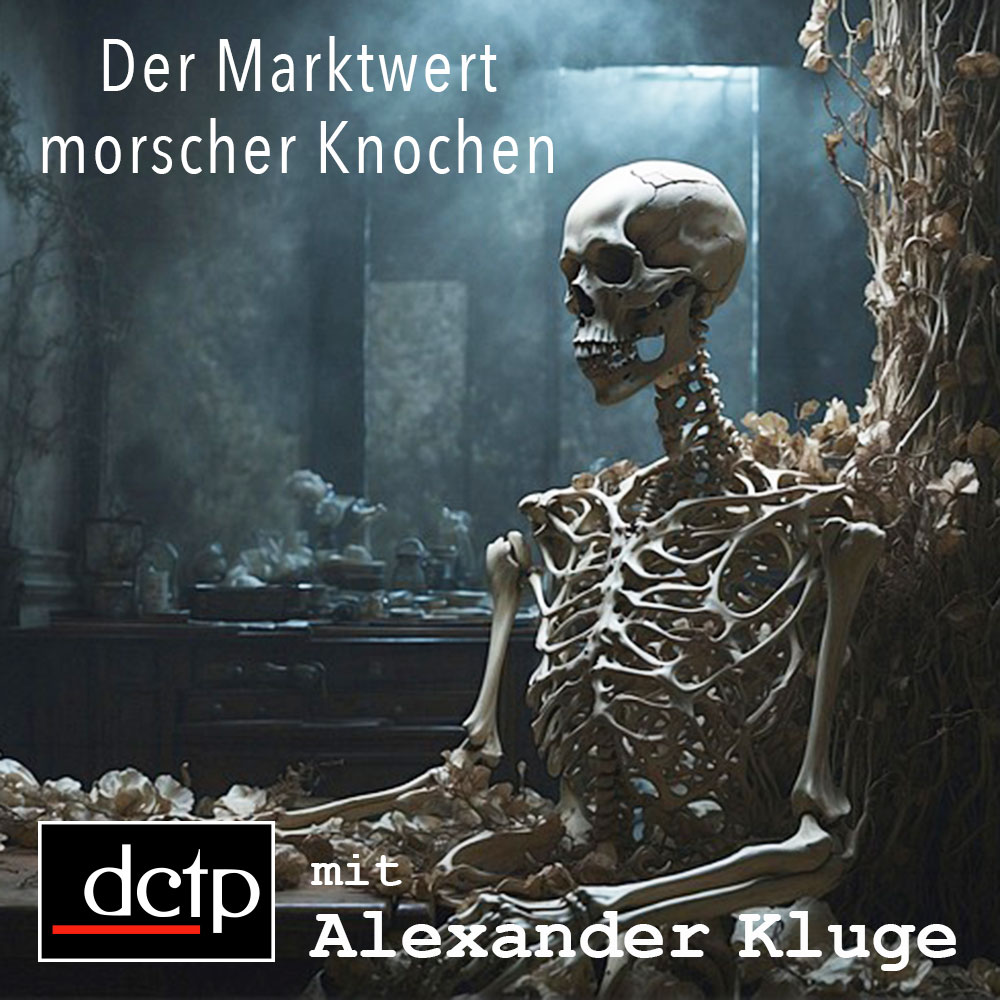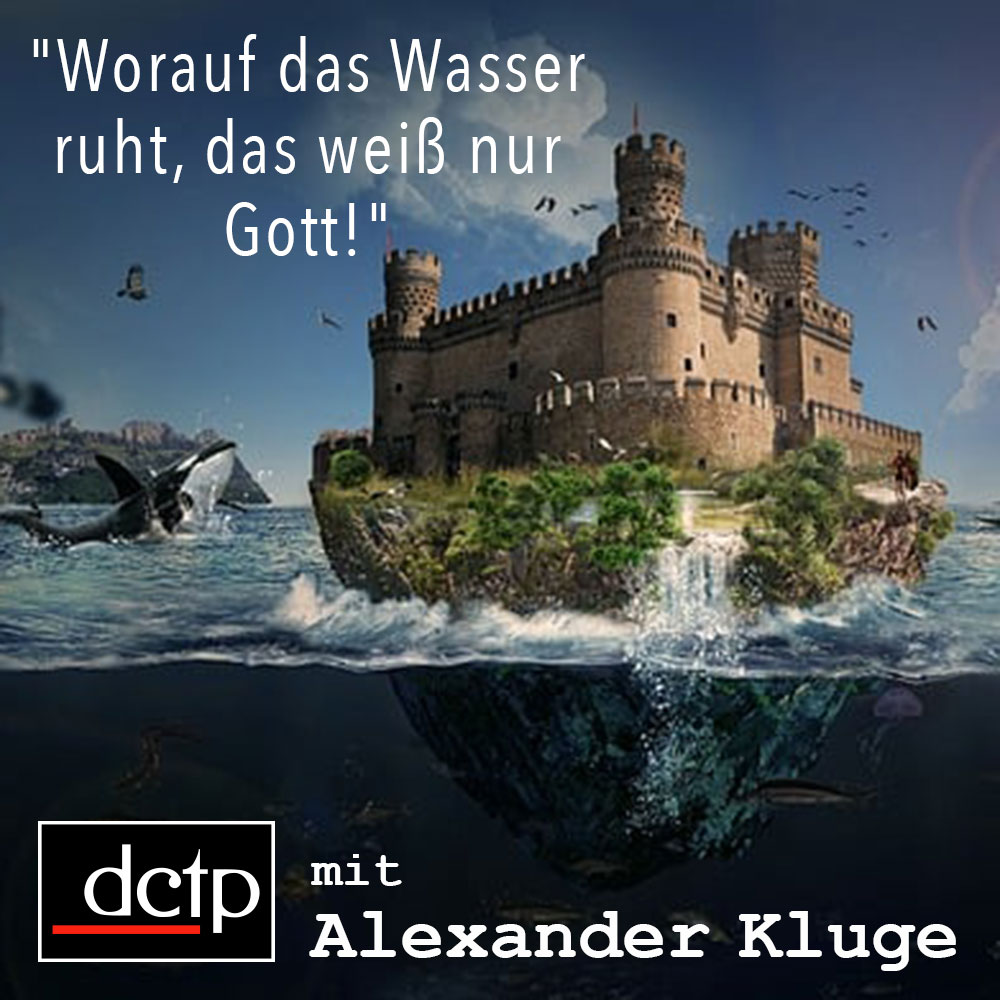Wissen/Schaft
Auf Darwins Spuren
Im November 1859 erschien Darwins epochales Werk THE ORIGIN OF SPECIES. Die darin enthaltene Theorie beschreibt das fundamentale Gesetz, nach welchem durch Selektion und Mutation die Evolution die Vielfalt des Lebens zustande bringt. Darwin hatte zuvor mit seinem Forschungsschiffe “Beagle” die Welt bereist und die Beobachtungen gesammelt, die seiner Theorie zugrundeliegen. Dr. Jürgen Neffe, Autor und Biologe, hat die Route Darwins neu bereist. Er berichtet über Darwins Leistung, aber auch über den Weg Darwins und wie er heute aussieht.
Mit Geologenhammer und Messband
Prof. Dr. Bernd-Dietrich Erdtmann ist Makro-Paläontologe. Sein Fach bezeichnet er als Geo-Biologie. Die meiste Zeit verbringt er im Gelände in China. Sein Interesse gilt den lebendigen Vorzeiten auf unserem BLAUEN PLANETEN, der bei näherer Betrachtung selbst ein Stück Leben zu sein scheint. Forschung mit Geologenhammer und Messband.
Ich bin ein Liebhaber des Blauen Planeten
Ein Drittel der Erdoberfläche besteht aus Wüsten. Sie bilden einen extremen Lebensraum für Pflanzen, Tiere und Menschen. Der Diplom-Geograf Michael Martin, der mit seiner Lebensgefährtin auch Filme herstellt und seine Reisen fotografisch festhält, hat mehr als 100 Wüsten durchfahren. Die Wüsten zeigen Grausamkeit, Schönheit und Vielfalt. Es gibt vier voneinander verschiedene Arten von Wüsten auf der Erde, neben den Eiswüsten. Begegnung mit Michael Martin.
Die Macht des Zwerchfells
Das Zwerchfell ist eines der stärksten Muskelgewebe im menschlichen Körper. Unter bestimmten Bedingungen setzt es sich unbeherrschbar in Bewegung und erschüttert alles, was oberhalb und unterhalb im Menschen ist: Herz, Lunge, Eingeweide. Kann ein Pferd lachen? Selbstverständlich, aber nicht über Witze. Es muss, um zu lachen, vom Stallburschen gekitzelt werden. Diese Reaktionsfähigkeit höherer Lebewesen, auf Kitzeln mit Lachlust zu antworten, ist in der Evolution eine der ältesten Eigenschaften. Man weiß bis heute nicht, ob sie physischer oder seelischer Natur ist. Im Mittelalter ist sie unter dem Namen “das fette Lachen” (le gros rire) bekannt und im grotesken Werk des größten französischen Dichters Rabelais und im deutschen TILL EULENSPIEGEL dokumentiert. TILL EULENSPIEGEL hat nichts mit einem Spiegel und einer Eule zu tun, sondern mit einem Handwerkerausdruck. Der Name bedeutet dechiffriert: König Leckarsch. Das Leben und die Schwänke dieses Mannes ziehen sich über 300 Jahre hin. Eulenspiegel war in Rom, in Prag, meist aber in Sachsen-Anhalt und Niedersachsen. Die meisten Geschichten lassen sich heute, ihrem Erfahrungsgehalt nach, nicht mehr entziffern. Der Kulturforscher Dr. Rainer Stollmann behauptet aber: Ein Prozess der Aufklärung, der sich nicht bloß auf das Denken und das klassische Ideal 30-jähriger Kaufmannssöhne (die Bildungsromane bevölkern) stützt, sondern auf das “fette Lachen”, hätte die Kraft, mit jeder Herrschaft fertig zu werden. Lachlust besiegt jede Autorität, so bewaffnet diese auch sein mag.
Der Marktwert morscher Knochen
Die Familie des Zaren wurde in der Stadt Jekaterinburg im Ural (aus dieser Stadt stammt Boris Jelzin) erschossen und in einem Bergwerkstollen verscharrt. Noch immer besteht jedoch keine Klarheit über die Zuordnung der Knochen. Auf dem Schwarzmarkt werden, ähnlich wie bei Heiligen des Mittelalters, echte oder fiktive Teile dieser Toten angeboten und vermarktet. Wissenschaftler fragen, ob man aus Bruchteilen und Einzelteilen dieser Reste Nachfolger der Zaren klonen könnte.
Kooperation im Tierreich
Zu den erstaunlichen Tatsachen gehört, dass bei Tieren (und vermutlich dadurch auch bei den Menschen) die innerartliche Aggression schwächer ist als die Kooperation. Welche Geschichte haben Verlässlichkeit und soziale Beziehungen in der Evolution? Das hässlichste Tier, die Nacktmulle, weißlich, rosa, zahnstark und praktisch blind, kann als das kooperativste und sozialste Tier gelten. Auch Wölfe sind untereinander kooperative Jagdgenossen, auch wenn sie zur Beute hin aggressiv sein können. Welche Tiere sind durch den Menschen bestechlich, welche nicht? Hunde sind so domestiziert, dass sie leicht zum Gehorsam zu verführen sind. Katzen dagegen bleiben auch gegen Belohnungen immun und eigensinnig. Als das eigensinnigste Tier kann die Oryx-Antilope gelten. Sie ist überhaupt nicht domestizierbar und durch nichts zum Gehorsam zu bringen: ein Einzelgänger an und für sich. Dieses Tier wäre in Ägypten und im Nahen Osten ein ideales Haustier gewesen. Es braucht wenig Wasser und ernährt sich auf der Futtersuche stets selbst. Es schmeckt köstlich. Die Domestizierung misslang vollständig. Die Sage vom Einhorn bezieht sich auf diese Ory-Antilope.
Der Evolutionsbiologe Prof. Dr. Joseph H. Reichholf entfaltet ein buntes Kaleidoskop über die Evolution der Zusammenarbeit im Tierreich.
Der Daumen ist der ganze Mensch!
Seit 3,5 Milliarden Jahren gibt es Leben auf der Erde. Seit 500 Millionen Jahren existieren Skelette von Tieren. Sie zeigen die Evolution in einer verblüffenden Übersicht, abstrakt und gewissermaßen in künstlerischer Eleganz. Der Autor und Biologe Jean-Baptiste de Panafieu und der renommierte Design-Fotograf Patrick Gries haben die interessantesten Skelette zusammengestellt und in einer einzigartigen Bildpublikation kommentiert. Die Findigkeit und Spontaneität der Evolution, die verblüffende Einfachheit ihrer Elemente und die Vielfalt der Gestalten im Ganzen gehören zu den Wundern unseres Planeten. Der höchst praktische, den Fingern gegenüberstehende Daumen und der fast funktionslose große Zeh gehören zu den Neuerungen des Menschen gegenüber seinen nächsten Verwandten: “Der Daumen ist der ganze Mensch”, sagt de Pannafieu. Begegnung mit dem französischen Biologen und Publizisten.
Worauf das Wasser ruht, das weiß nur Gott!
Eliot Weinberger von der Zeitschrift “The New Yorker” gilt als der bedeutendste Essayist der USA. Seine Texte bewegen sich in der Gegenwart ebenso wie den frühsten Zeiten der Menschheit: Eine Zeitreise über 6.000 Jahre. Eine seiner fantasiestarken Erzählungen handelt von Mohammed und dem sagenhaften Fisch Tamusa, auf dessen Rücken die Menschheit siedelt. Die Erde, heißt es dort, ruht auf dem Wasser. Aber auf welchen Abgründen ruht dieses Wasser? Begegnung mit Eliot Weinberger.