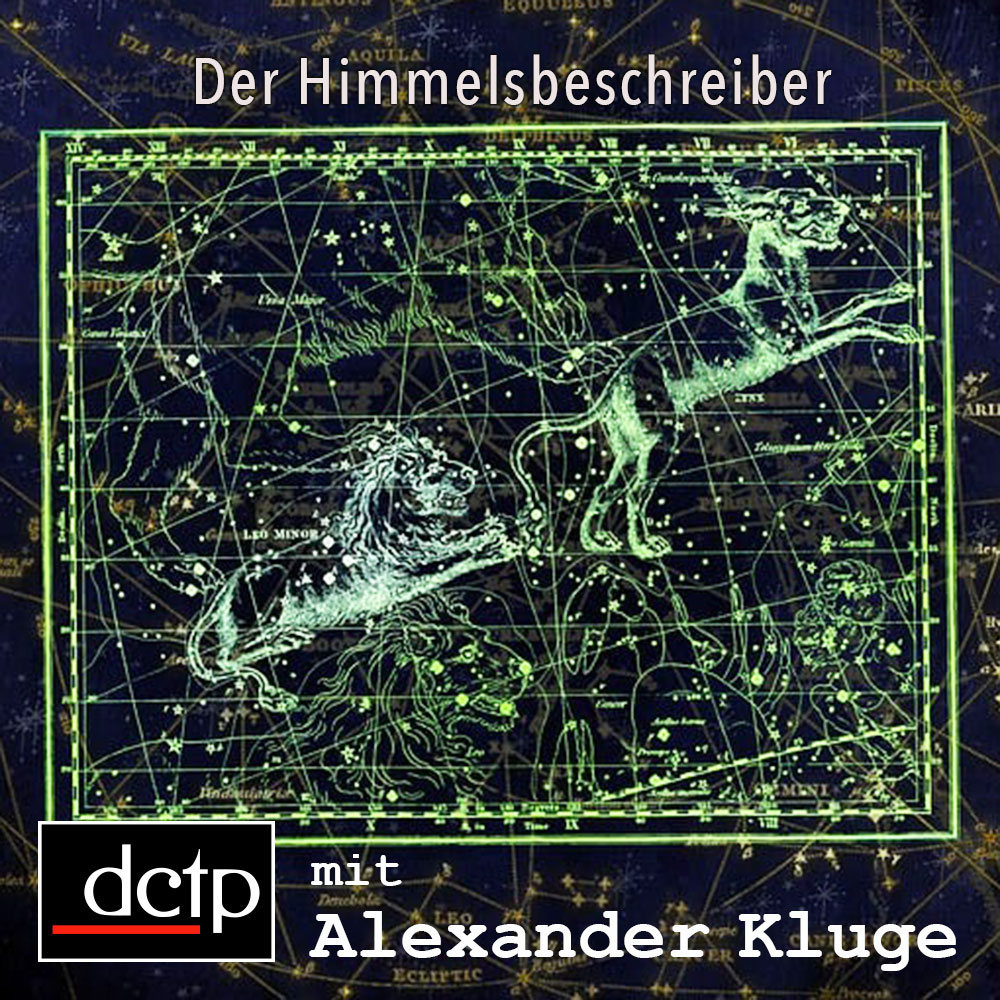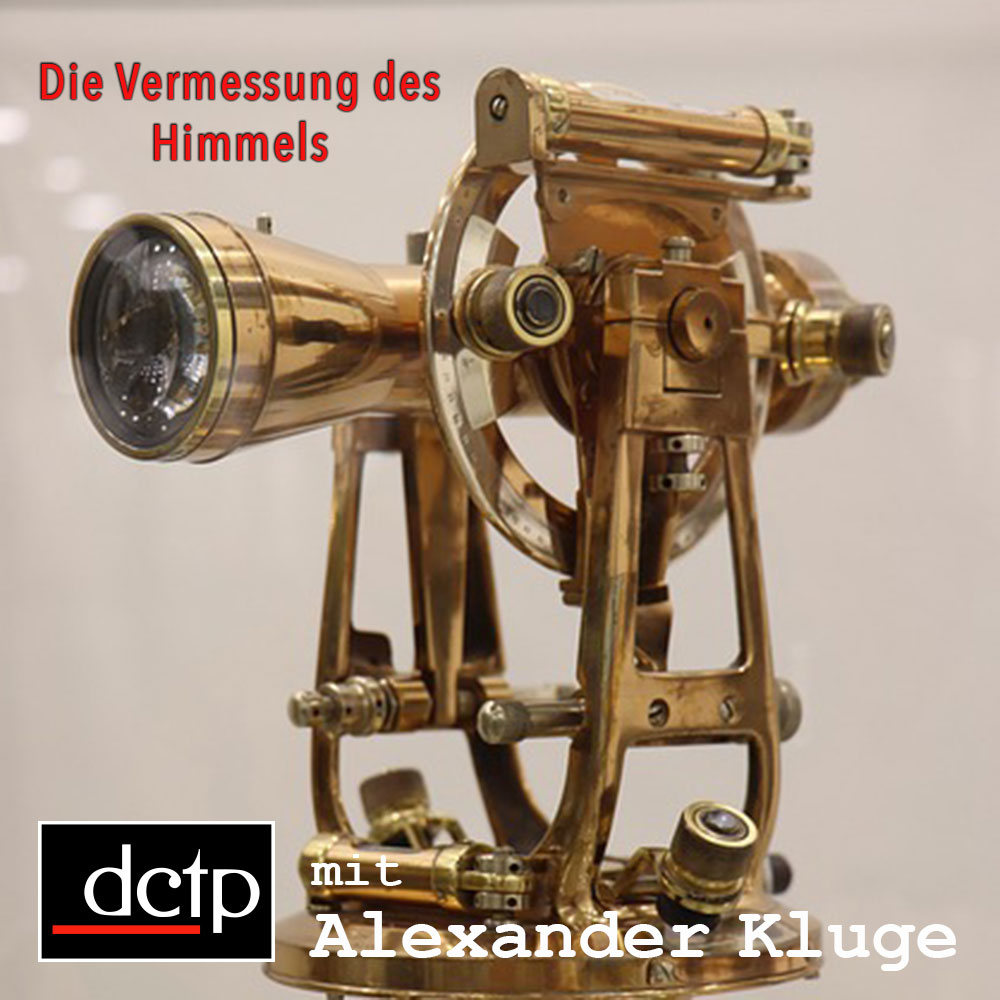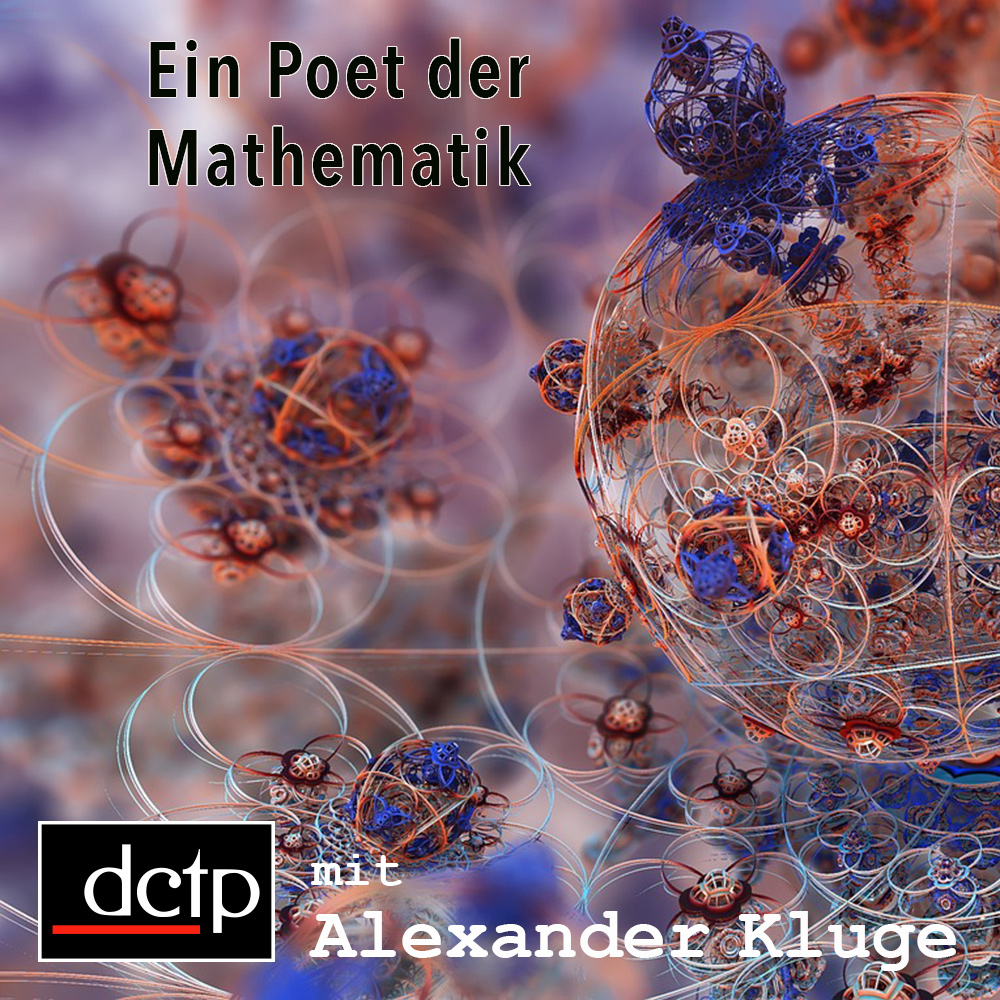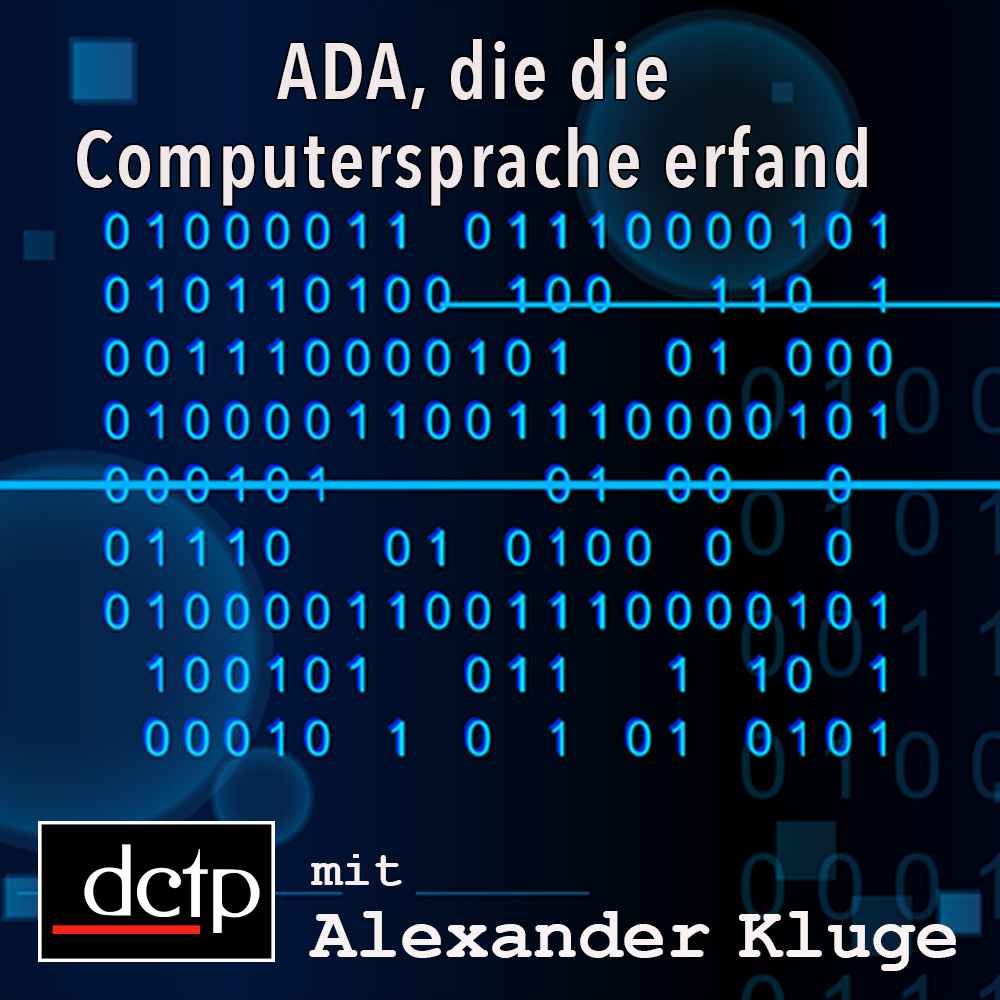Lord Byrons Tochter hieß “Ada” Byron King. Sie erfand die Computersprache und noch heute heißt das vom U.S.-Pentagon benutzte Computersystem ADA. Sie war ein Wunderkind und Frühgenie. Die Mutter wollte sie vor dem Schicksal des berühmten Dichtervaters bewahren. Deswegen wurde sie vor jeglicher Poesie gehütet und vor allem in Mathematik unterrichtet. Das führte zu dem Ergebnis, daß Ada mit poetischer Besessenheit mathematische Sprachen entwickelte und die Computersprache kombinierte.
SIe tat dies mit Männern, die sie für sich interessierte: pervers, brilliant, obsessiv, mathematisch, d.h.: durch und durch Lord Byrons Tochter.
Die U.S.-Filmemacherin Lynn Hershmann Leeson beschreibt in ihrem Film CONCEIVING ADA wie eine Frau von heute, computerbegeistert, im Cyberraum Kontakt mit der seit 144 Jahren toten Ada aufnimmt. Diese junge Frau von heute begibt sich über ein Interface, das ihr Timothy Leary 9 Tage vor seinem Tod beschafft, in den Cyberspace, obwohl sie schwanger ist. Ihr Kind wird später geboren, behaftet mit der Persönlichkeit und dem Gedächtnis von Ada, die sich auf diese Weise unsterblich zeigt.